Aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen: Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Die Comicgate-Redakteure Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: City of Glass: The Graphic Novel von Paul Auster, Paul Karasik und David Mazzucchelli und Asterios Polyp von David Mazzucchelli. Als Gastrezensent diesmal mit dabei: der luxemburgische Lokalfeuilletonist und Astralstatiker Janus M. Hirsch.
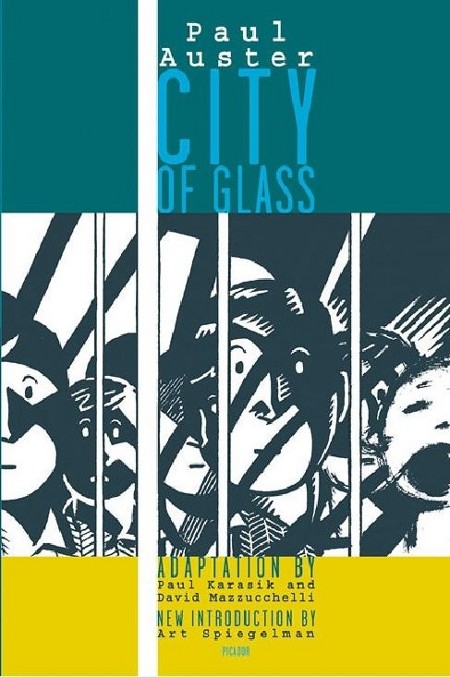
WEDERHAKE: Frisch, dass es seit meiner, deiner, unserer letzten „2gegen1“-Besprechung so lange gedauert hat, ist dem Umstand geschuldet, dass ich hochgradig irritiert war. Wie ja allgemein bekannt ist, und wie du, ich, wir ja durch subtile Hinweise in deinen, meinen, unseren Texten und dem Namen „2gegen1“ angedeutet haben (sind es 2 Personen gegen jeweils 1 Comic oder 2 Comics gegen jeweils 1 Person?), sind wir ja Facetten derselben Person, die uns Worte in den Mund legt. Und bisher funktionierte das ja auch ganz wunderbar, wir waren uns einig. Wir waren 1. Und dann gehen du, ich, wir plötzlich bei Guy Delisles Jerusalem völlig auseinander und ich frage mich, was das über dich, mich, uns aussagt. Bin ich jetzt noch ich? Bist du jetzt noch du? Und bist du noch ich? Bin ich noch du? Wer sind wir? Und wer ist der Mann, der unter diesen Pseudonymen B.W. und M.-O.F. schreibt? T.K.? S.T.? D.W.? D.Q.? Ist das noch dieselbe Person?
Schwierige, kopfschmerzinduzierende Fragen, mein Alter Ego, die dann dazu führten, dass ich eine Pause brauchte; die ich genutzt habe, um thematisch angemessen Paul Karasiks und David Mazzucchellis Umsetzung des klassischen Paul-Auster-Romans City of Glass zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zu lesen. Das ist nominell eine Detektivgeschichte, in der der Autor Daniel Quinn einen scheinbar für den Privatdetektiv Paul Auster bestimmten Anruf erhält und sich entschließt, den Fall trotz der Verwechslung zu übernehmen. Tatsächlich ist die Form der Detektivgeschichte aber nur ein Konstrukt, das Auster nutzt, um eine Menge postmoderner Ideen über das Verhältnis zwischen Werk und Künstler, Doppelgängerei und die puddinghafte Konsistenz von persönlicher Identität zu präsentieren, die mir beim Lesen des Romans durchaus Spaß bereitet haben.
Die Frage ist, wie setzt man so ein Buch um, das nur minimalen Antrieb durch aktive Handlung hat und primär aus sprechenden und philosophierenden Personen besteht? Werden 130 Seiten Talking Heads nicht langweilig? Laut dem von Art Spiegelman verfassten Vorwort hatte Mazzucchelli dasselbe Problem und erst als man Paul Karasik hinzuzog, fand der Comic seine Form. Und was das für eine Form ist. Karasik und Mazzucchelli verstehen nämlich, dass eine Adaption sich immer überlegen sollte, welche Stärken und Vorteile das Medium mit sich bringt, in das ein Werk adaptiert wird. Hier bedeutet das konkret, dass man sehr stark und immer wieder auf visuelle Metaphern und Allegorien setzt, die in Austers Roman schlicht nicht zu finden waren. Das Leitmotiv der Frage nach der Realität von Identitäten wird gleich am Anfang dadurch visualisiert, dass der Leser das Klingeln eines Telefons als Klangwort sieht, so wie scheinbar das dazugehörige Telefon. Nur um beim Rauszoomen zwei Panels später festzustellen, dass es bloß das Bild eines Telefons auf jenem Telefonbuch war, auf dem das echte Telefon steht. (Wenn du noch metatextueller werden möchtest, Frisch, kannst du als frankophone Saarlouise natürlich auch anmerken, dass ceci n’est pas un téléphone.) Nichts ist sicher, nichts ist real.
An anderen langschwafeligen Stellen nutzen die Künstler die Gelegenheit, um von einem Panel zum nächsten zu morphen, dass es eine Freude ist: Da wird der Halbmond zur Apfelsine und eine Skyline zu einem Strichgewirr und das wiederum zu einem Labyrinth von oben, das sich beim Rauszoomen als Fingerabdruck an der Scheibe vor besagter Skyline erweist. An anderer Stelle wird eine Geschichte nur mit Piktogrammen untermalt. Und da ist jener Moment, in dem eine Figur davon spricht, dass am Anbeginn der Welt Wort und von ihm repräsentierter Gegenstand austauschbar waren (signifié = signifiant, womit wir wieder zum Telefon vom Anfang zurückkommen). Das stellen Mazzucchelli und Karasik dann dar, indem Adam seinen Schatten „Schatten“ nennt und dann in den folgenden Panels statt eines gezeichneten Schattens das Wort „Schatten“ an seinem Körper klebt. In diesem Kontext hat die Aussage „What Quinn liked about mysteries was their economy. There is no sentence, no word that is not significant (!)“, plötzlich eine Bedeutung erhalten, die sich mir beim bloßen Lesen des Romans nicht erschlossen hatte. Die Comicumsetzung hatte für mich also einen Mehrwert, was vielleicht das größte Lob ist, das man einer Adaption aussprechen kann.
Ich muss aber auch zugeben, dass mich die visuelle Umsetzung gelegentlich überfordert hat. Die Bedeutung der Bilder, die den Monolog Peter Stillmans des Jüngeren untermalen (jenes Menschen, der Daniel Quinn anheuert), erschließt sich mir oft nicht, obwohl es rein formal sehr beeindruckend ist, wie zuerst konstant über drei bis neun Panels hinweg an etwas herangezoomt wird und das Zoomen dann immer weniger Panels in Anspruch nimmt, bis am Ende jedes Panel einen neuen Gegenstand zeigt, was ich als gezeichnete Variante eines „Schnittgewitters“ im Film ansehen würde.
Ein anderes Element, das im Comic hinzu kommt und im Roman natürlich nicht zu finden war, ist der Seitenaufbau: Den ganzen Comic hindurch wird die Geschichte innerhalb eines hochformalen 9-Panel-Grids erzählt, was zunächst nur eine stilistische Entscheidung zu sein scheint. Bis auf Seite 22 der Gutter zwischen den Panels ersetzt wird durch die vier Eisenstangen einer Gefängnistür. Und – POW! – auf einmal ist das gewählte Gittermuster auch ein Symbol dafür, wie man in etwas gefangen ist. Was auch immer dieses Etwas sein mag. Wenn dann auf Seite 60 ein zusammengehöriges Bild in neun Panels zerschnitten wird, dann sehe ich da wieder die Eisenstangen. Daniel Quinn ist gefangen in dem Fall, der nie an ihn, sondern immer an Paul Auster gehen sollte. Ganz zu schweigen davon, dass dieses 3-mal-3-Muster plötzlich überall im Comic als visuelles Leitmotiv auftaucht: Die Tasten eines Telefons, Postfächer, Fensterrahmen. Erst am Ende der Geschichte, wenn Daniel Quinn sich selbst verliert (oder, je nach Lesart, feststellt, dass seit dem Tod seiner Familie ohnehin kein Daniel Quinn mehr existierte) und überhaupt nicht mehr weiß, wer er noch ist oder je war, erst da wird das rigide Gittermuster mit maximaler Effektivität gesprengt. Ich kenne wenige Comics, in denen Inhalt und Form so schön und gekonnt zusammenspielen.
Dazu passt auch, dass zum Ende hin, wenn Quinn seinen Bezug zur Welt und der Realität verliert, die Zeichnungen zunehmend grobschlächtig und skizzenhaft werden – so wie schon vorher eine Passage über Obdachlose und die Verlierer unserer Gesellschaft holzschnittartig und leicht U-comixig dargestellt wurde. Solche kleinen, genialen Momente durchziehen den ganzen Comic: Weiß Quinn nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll, dann passiert das in einem Panel ohne Umrandung und mit viel Weißfläche. Und an anderer Stelle entspricht die Körperhaltung einer Figur exakt der Körperhaltung eines Aufziehmännchens, an dem sie vorbei geht. Bestimmte Interpretationsansätze, die mir im Roman entgingen, wurden mir erst in der komprimierten Form des Comics präsent: Dass Daniel Quinn zunehmend so geht wie Peter Stillman der Ältere (den er für Peter Stillman den Jüngeren beschattet). Dass Paul Austers Sohn (auch Daniel) dieselbe Tendenz zum Reimen hat wie Peter Stillman der Ältere.
Einzig, ein zentrales Element des Buches funktioniert in der Umsetzung nicht so effektiv: Immerhin geht es in Austers Roman auch immer wieder darum, wer wir eigentlich sind und ob es einen individuellen Daniel Quinn gibt oder ob mehrere (oder alle?) Figuren in dieser Geschichte doch eigentlich dieselbe Person sind. „Everybody’s Daniel“, wie Austers Sohn feststellt. Dadurch, dass aber die visuellen Darstellungen der Figuren hier doch in vielen Bereichen sehr distinkt sind, muss man ein feines Gespür für diese Subtilitäten mitbringen oder, weil man das Buch schon gelesen hat, bereits im Vorfeld auf dieses Element eingestellt sein, um sich als empfänglich zu erweisen.
Trotzdem, Frisch, in einem mit total unnützen Umsetzungen vollgeramschten Feld sticht Karasiks und Mazzucchellis City of Glass wohltuend heraus, weil es dem Wesen des Romans treu bleibt, es dabei aber schafft, weitere, nur im Rahmen eines Comics mögliche Elemente hinzuzufügen, die dem Leser eine zusätzliche Ebene bieten, auf der er die Geschichte interpretieren und analysieren kann. Insofern sollte man den Comic wohl nicht als Ersatz des Buches sehen, sondern eher als Ergänzung. So geht das.
Und jetzt, Frisch, frage ich mich, welche Antwort ich mir dazu unter deinem Namen geben werde.
![]()
* * *
FRISCH: Ich will nicht grob sein, Wederhake, du alte Facette, aber Karasiks und Mazzucchellis City of Glass ist weder ein „Ersatz“ noch eine „Ergänzung“ der Vorlage. Wenn der Comic überhaupt irgendwas ist, dann ein Witz, genau wie Austers Roman auch. Doch dazu später mehr.
5.
Ich weiß, du meinst es gut, aber mit der Adaption als Ersatz oder Ergänzung eines „Originals“ tu ich mich schwer. In erster Linie geht’s doch darum, was Eigenes zu schaffen – und zwar mit ganz anderen Mitteln.
Natürlich ist es nett, wenn Kubricks 2001 den Lesern von Clarkes 2001 – Film und Roman sind in diesem Fall gleichzeitig und in Zusammenarbeit zwischen Autor und Regisseur entstanden – neue Dimensionen zur Interpretation eröffnet, oder umgekehrt. Aber der Reiz, den Stoff in verschiedenen Medien zu präsentieren, ergibt sich doch gerade daraus, dass so wieder etwas komplett Neues entsteht. Ich habe Clarkes 2001 nie gelesen, und ich werd’s auch in naher Zukunft nicht tun. Trotzdem vermisse ich an Kubricks 2001 nicht das Geringste. Der Film gibt mir alles, was ich brauche, um ihn als eigenständiges Werk zu erkennen. Gleichzeitig freue ich mich darauf, mir endlich mal Kirbys 2001 zu Gemüte zu führen – nicht, weil ich mir davon neue Erkenntnisse zu Kubricks Version erhoffe, sondern weil ich weiß, dass das Resultat wieder völlig anders ausfällt.
Der Roman ist der Roman, der Film ist der Film, der Comic ist der Comic. Ergänzung? Von mir aus, ist bei mehreren Interpretationen desselben Stoffs ja fast unvermeidlich. Aber davon, dass eine Interpretation die andere ersetzen müsste, sollte, könnte, wollte, kann doch keine Rede sein. Wer weiß, vielleicht wagt sich irgendwer irgendwann ja mal an eine Neuverfilmung. Die wäre dann auch wieder ihr eigenes Ding. Eine thematisch verwandte und – unabhängig von der jeweiligen Qualität – gleichwertige Koexistenz ist keine Schande, und eins nimmt dem andern auch nichts weg.
4.
Dieser Aspekt interessiert mich auch darum besonders, weil ich mich kürzlich über die Comic-Ausgabe der Neuen Rundschau (3/2012) geärgert habe. Da stehen viele gescheite Texte drin und einer von Christoph Haas. Unter dem unheilschwangeren Titel „Graphische Romane? Zum schwierigen Verhältnis von Comic und Literatur“ (S. 47-63) macht Haas sich dort alsbald Gedanken über den vermeintlichen Impetus von Comic-Adaptionen:
„Ein durchschnittliches oder mit Mängeln behaftetes Werk kann inspirieren, es in einem anderen Medium zu verbessern; es gleicht einem Bauplan, der erst noch umzusetzen ist. Das Meisterwerk dagegen kann begeistern; der Grad der Vollendung, der sich in ihm zeigt, lähmt aber die eigene Kreativität.“ (S. 50)
Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu dieser Feststellung.
Natürlich ist Haas mit seiner Meinung nicht alleine. Jeden Tag kommen Menschen aus Kinos und streiten darüber, ob nun „der Film“ besser sei oder vielleicht doch „das Buch“. Und für Menschen, die gerade aus dem Kino kommen, ist das auch total legitim.
Auf der Ebene der kritischen Auseinandersetzung sollte man inzwischen allerdings weiter sein. Stand es für Marguerite Donlon, als sie Romeo und Julia in Ballettform auf die Beine stellte, im Mittelpunkt ihrer Überlegungen, ob ihre Version Shakespeare überflügeln oder im Vergleich unterliegen würde? Ich bin da eher skeptisch.
Natürlich können Adaptionen Teilaspekte des Originals – Plot, Figuren, Darstellung, Ausstattung, Dialoge, etc. – verbessern; und genauso können sie daran scheitern, zentralen Aspekten der Vorlage gerecht zu werden. Aber weder der eine noch der andere Fall sind mehr als Nebenprodukte des Ansatzes, dem Stoff mit anderen Mitteln auf die Pelle zu rücken. Jede gelungene Adaption erfindet auf ihre Weise das Rad neu, was den gewählten Stoff angeht – ganz unabhängig davon, in welcher Form und in welchem Medium dies geschieht. Wer Mängel beseitigen möchte, der braucht keine Adaption, sondern einen Handwerker.
Haas nimmt danach – zu Recht – die Knesebeck’sche Comic-Adaption von Kafkas Verwandlung auseinander. Es ist eine dieser traurigen 08/15-Nacherzählungen, von denen der Markt seit Jahren überschwemmt wird. Die Autoren wussten sich offenbar nicht anders zu helfen, als den Plot der zugrunde liegenden Vorlage möglichst unfallfrei und mit aufs Banalste wörtlichen Bildern zu reproduzieren. Haas identifiziert und erläutert das Problem dieser Vorgehensweise durchaus überzeugend, versteigt sich dann aber ohne Not zu einer weiteren steilen These:
„Aber hätte man es viel besser machen können […]? Die Antwort kann nur lauten: Nein. Die Unterschiedlichkeit der Medien erlaubt es nicht. Was in der Literatur nur Wort ist, muss im Comic zwangsläufig Bild werden; es muss zur Anschauung gebracht werden. In der Erzählung lernt der Leser die Welt mit Gregors Käferaugen zu sehen; in der Graphic Novel sieht er Gregor als Käfer. An diesem kleinen Unterschied muss jede Anstrengung eines Zeichners zuschanden gehen.“ (S. 53)
Und damit wären wir wieder bei City of Glass, denn es ist der papiergewordene Gegenbeweis zu Haas‘ Nonsensbehauptung. Karasik und Mazzucchelli machen es besser. Sie erfinden tatsächlich das Rad neu.
3.
Dabei ist City of Glass sogar eine vergleichsweise klassische Adaption, denn hier werden keine wesentlichen Handlungselemente umarrangiert oder ausgelassen, und es wird im Vergleich zur Vorlage auch nicht groß abstrahiert. Aber anders als die erwähnte Kafka-Adaption (oder auch Kleists Boxer) klebt City of Glass nicht an seinem Plot, sondern lebt vor allem von der Neu-Inszenierung und visuellen Zuspitzung der schon bei Auster reichlich vorhandenen abstrakten Elemente.
Ein Paradebeispiel dafür ist der an Protagonist und Pseudodetektiv Quinn gerichtete Monolog des jungen Peter Stillman (S. 15-23) – die vielleicht verstörendste monologische Höllenfahrt der Literatur, seit Stephen Dedalus in Portrait of the Artist die Leviten gelesen bekam.
Im Roman umfasst dieser Monolog in meiner Ausgabe sieben Seiten, bei Karasik und Mazzucchelli sind es immerhin neun: neun Seiten, auf denen keinerlei Handlung stattfindet; neun Seiten, deren Vorlage ein reiner Monolog ist, ohne Unterbrechung durch den Erzähler; neun Seiten, die den Text der Vorlage um 50 bis 75 Prozent einkochen und das resultierende Konzentrat auf 65 Sprechblasen (sieben Seiten mit je neun Blasen, plus zwei Seiten mit je einer Blase) aufteilen.
Die ersten sieben dieser neun Seiten bestehen aus Neun-Panel-Gittern mit jeweils einer Blase pro Panel, sowie teils surrealen Bildern, die mit dem Text in keinem direkten Zusammenhang stehen. Auf der ersten Seite (S. 15) wird immer näher auf das hölzern wirkende Gesicht Stillmans und schließlich in seinen Rachen hineingezoomt. Die Perspektive wird praktisch von Stillman verschluckt, während er redet – darüber, wie schwer es ihm fällt zu reden, und wie er vom Tod seiner Mutter erfuhr. Was wir lesen, kommt nicht aus seinem Mund, sondern tief aus seinem Innern. „Ich bin Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name.“
Die zweite Seite (S. 16) scheint zunächst eine weiße Leere zu zeigen, die sich jedoch als Wasseroberfläche entpuppt, aus der dann nach und nach ein Fährmann samt Gondel und Riemen aufsteigt, dessen von einer Kapuze verhülltes Gesicht sich nun als Quelle der Sprechblasen herauszustellen scheint. Der Fährmann wird Quinn – und den Leser – nun hinüberbringen in den seelischen Hades Peter Stillmanns. Der teils wirre Text deutet darauf hin, dass Stillman als Kind in einem dunklen Raum gefangen gehalten, gefüttert und geschlagen wurde. Es ist von Exkrementhaufen und Urinpfützen die Rede, einem dunklen, „sehr dunklen“ Raum. Und wieder: „Ich bin Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name.“
Auf der dritten Seite (S. 17) wiederum wird an das Gesicht des Fährmanns herangezoomt, das nun sichtbar wird: Noch stärker als Stillmans eigenes macht es einen hölzernen Eindruck, ähnelt einer geschnitzten Heiligenfigur. Aber wie schon zwei Seiten zuvor bei Stillman verschwindet der Zipfel der Sprechblasen zusammen mit der ganzen Perspektive erneut im Rachen der Figur. Der Fährmann setzt uns nicht bloß über, sondern wir müssen in ihm versinken, um zu erfahren, was mit Stillman geschehen ist. Im Alter von zwölf Jahren wurde er gefunden. Aufgrund der langen Isolation konnte er nach seiner Befreiung weder klar denken noch sprechen.
Im ersten Panel der vierten Seite (S. 18) wieder Leere, bevor ab dem zweiten Panel eine Art Höhlenmalerei erscheint – vielleicht die Gestalt eines Mannes, der von einem Stier angegriffen wird, daneben ein kleiner Vogel. Die Sprechblasen scheinen nun zunächst ihren Ursprung am Kopf des Mannes zu haben, doch je näher herangezoomt wird, desto eher könnte es auch der Kopf eines Hasen oder Vogels sein. (Die Zeichnung basiert auf einer echten Höhlenmalerei.) Stillman (der Junge mit dem Vogelkopf?) war 13 Jahre lang von seinem Vater (dem Minotaurus?), der ebenfalls Peter Stillman heißt, eingesperrt worden. „Wir beide sind Peter Stillman. Aber Peter Stillman ist nicht mein richtiger Name. Also vielleicht bin ich gar nicht Peter Stillman.“
Auf der fünften Seite (S. 19) dann ein Bruch: Das erste Panel jeder horizontalen Dreier-Reihe zeigt ein neues Motiv vor weißem Hintergrund, das in den beiden folgenden Panels langsam herangezoomt wird. Keines der drei Anfangspanels steht dabei im Zusammenhang mit der vorangegangenen Dreier-Reihe oder Seite. Der erste horizontale Streifen zeigt das Gitter eines Gullydeckels in einer Straßenrinne; der zweite den Abfluss einer Dusche oder Wanne; der dritte ein Grammofon.
Der Sprecher versucht, das Handeln von Stillmans Vater zu erklären. Auf der Suche nach einer „Sprache Gottes“ sei der gewesen. Dadurch, dass er seinen Sohn einsperrte und von allen menschlichen Einflüssen fernhielt, dachte er, er könne diese göttliche Ur-Sprache in dem Kind hervorbringen. Die Zipfel der Sprechblasen kommen jeweils aus dem Gully und dem Abfluss (Unrat, Abwasser) und dem Grammofon – vielleicht ein Hinweis auf das „mechanische Flüstern“ Stillmans (so wird seine Stimme bei seinem ersten Telefongespräch mit Quinn im Roman beschrieben) oder auf seinen Scatsprech, der an eine Schallplatte mit Sprung erinnert. („Wimble click crumblechaw beloo. Clack clack bedrack. Numb noise, flacklemuch, chewmanna. Ya ya ya.“)
Die sechste Seite (S. 20) wird erneut kurzatmiger: Hier gibt es nach jedem zweiten Panel einen Bruch. In den ersten beiden wird an einen Brunnen herangezoomt; in den nächsten beiden an ein Nest, in dem ein kleiner Vogel mit aufgerissenem Schnabel sitzt; dann an den Ausschnitt eines Comicstrips aus der Reihe „Henry“ von Carl Anderson (siehe „Coffee with Paul Karasik“ von Bill Kartalopoulos), in welchem die gleichnamige Hauptfigur die berühmte Szene mit dem Schädel aus Hamlet nachspielt: „Ich kannte ihn, Horatio!“ Bloß: Henry ist eigentlich stumm; danach ein Haufen Hundekot, um den Fliegen kreisen; und im letzten Panel der Seite schließlich nur noch eine Sprechblase, die ins Nichts führt.
Die Sprechblasen der anderen Panels haben ihren Ursprung jeweils tief im Brunnen (da unten muss es ähnlich dunkel und eng sein wie in Stillmans Verließ), im Rachen des Vogels (ein hilfloser kleiner Vogel, der nicht fliegen kann und gefüttert werden muss; vgl. den Vogelkopf auf Seite 18), in Henrys Mund (der etwas sagen will und doch nicht reden kann) und in der Mitte des Kothaufens (Stillman war umgeben von seinen eigenen Fäkalien). Der Text bekundet, dass Peter verprügelt worden sei, wenn er sprach, und deshalb bald aufhörte zu reden. Er habe darum nun die Sprache Gottes „im Kopf“. Außerdem lasse er sich von seiner Frau Prostituierte zum Geschlechtsverkehr bringen – und er würde sich freuen, wenn seine Frau mit Quinn schliefe.
Das Rund des Brunnens „reimt“ sich auf das Rund des Vogelnests, der Winkel des Schnables entspricht dem Winkel des gezeigten Comicstrips, und der Hundehaufen wiederum „reimt“ sich auf den Brunnen und das Vogelnest (siehe Kartalopoulos/Karasik): „Ba ba ba, sagte er. Und da da da.“ (S: 17) „Und bumm bumm bumm. Die Kaka-Haufen. Die Pipipfützen.“ (S. 16) „Ya ya ya.“ (S. 16) „Hat er gewunken? Hat er getrunken? Hat er gestunken? Ha ha ha.“ (16) Karasik und Mazzucchelli übersetzen die sprachlichen Eigenheiten ihrer Figur hier in ein visuelles Reimschema.
Auf der siebten Seite schließlich (S. 21) steht jedes Panel für sich: ein Kaninchen in einem Zylinder; ein Fläschchen mit Gift; eine Hand, auf die ein Gesicht gemalt ist; ein Fernseher, dessen Bildschirm gesprungen ist; ein Fläschchen Tinte; eine sechssaitige Gitarre; ein begonnenes Tic-Tac-Toe-Spiel mit je zwei Kreisen und zwei Kreuzen; ein Teddybär; und im neunten und letzten Panel schließlich wieder nur eine Sprechblase, die ihren Ursprung irgendwo in der Tiefe des Panels hat, jenseits des sichtbaren Bereichs.
Sind die einzelnen Motive hier Referenzen auf vorangegangene Seiten? Das Kaninchen vielleicht auf den „Hasen“ von Seite 18? Die Gitarre auf das Grammofon von Seite 19? Sind die neun Felder des Tic Tac Toe ein Kommentar zur Seitenaufteilung? Wieder fallen die „Reime“ aus kurvigen und eckigen Formen auf. Auch die Sprechblasen werden kleiner. Der Sprecher erzählt, dass er manchmal schreit, die Luft in Freiheit mag, sich nun besser zurechtfindet als nach seiner Befreiung und um seinen Geisteszustand weiß. „Fürs Erste bin ich Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name.“
Das Panelgitter wird auf der achten Seite (S. 22) dann zum sprichwörtlichen Gitter einer Gefängnistür vor schwarzem Hintergrund, um die sich der Zipfel einer einzigen Blase schlängelt: Mit großer Anstrengung sind Peter Stillman, Quinn und der Leser in dem dunklen Verließ tief im Innern Stillmans angelangt. Ein letztes Mal geht es nun tiefer hinein in die Finsternis, und auf der neunten und letzten Seite (S. 23), einer Splashpage, sehen wir den wahren Stillman in seinem Tartaros, so, wie er damals war und heute vielleicht noch ist: eine am Boden, inmitten von Unrat und Urin liegende Marionette.
Karasik und Mazzucchelli visualisieren mit dem Bild eine Beobachtung des Erzählers kurz vor Beginn des Monologs, die im Roman vorkommt, aber nicht im Comic: „Es war, als würde man einer Marionette zusehen, die ohne Fäden zu laufen versucht.“ Der auf diesen letzten beiden Seiten der Sequenz enthaltene Text drückt Stillmans Hoffnung aus, nach seinem Tod vielleicht zu Gott zu werden. Er bedankt sich bei Quinn und wiederholt noch einmal sein Mantra: „Ich bin Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name.“
Der Effekt dieser Sequenz ist eindringlich und verstörend; sie braucht sich hinter dem adaptierten Abschnitt der Vorlage nicht zu verstecken.
Karasik und Mazzucchelli demonstrieren meisterhaft, worum es bei einer Adaption geht. Ziel eines Romanautors ist es, mit Wörtern Bilder im Kopf des Lesers entstehen zu lassen. Der Comic geht diesbezüglich zwar direkter vor und liefert die Bilder – oder sagen wir: einige Bilder – gleich mit, doch das Ziel ist das gleiche. Es kommt nicht von ungefähr, wenn Chris Ware erklärt, dass er mit seinen Zeichnungen schreibt (siehe Mono.Kultur 30, 2011/2012, S. 8-11). Genau das tun Karasik und Mazzucchelli hier auch. Den Effekt, auf den Auster mit seiner Prosa abzielt, versuchen sie mit einer Mischung aus Bildern und Text zu erzeugen.
Was eben nicht zwangsläufig heißt, dass die Bilder Dinge zeigen, die im Originaltext genau so vorkommen. Wichtig ist, dass sie den gewünschten Effekt erzielen. Das ist die Aufgabe, an der viele Comic-Adaptionen scheitern: Ihre Autoren setzen sich zu wenig mit dem Effekt einzelner Szenen, Abschnitte, Sätze und Wörter auseinander und kleben viel zu sehr an den konkreten Bildern der Vorlage. Um es mit Ware zu sagen, „Comics sind Bilder zum Lesen, nicht nur zum Anschauen.“ (S. 11) Darum ist auch die Trennung zwischen „Comics“ und „Literatur“ Unfug. Ein Autor kann mit Text zeichnen oder mit Bildern schreiben. Der einzige Unterschied ist der Grad der visuellen Abstraktion.
(Ach ja, à propos Ceci n’est pas un téléphone und meta und so: Von Auster über Saussure und Magritte zu Mazzucchelli und Karasik? Kannste haben. Aber das Spiel lässt sich noch weitertreiben, von Mazzucchelli und Karasik zu… Karasick, sic: Adeena Karasick nämlich. Ceci n’est pas un téléphone, indeed, mein lieber Wederhake.)
2.
„Ich bin Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name.“
Wie du, Wederhake, als alter Pfiffikus in deiner metamäßigen Einleitung bereits angedeutet hast, betrifft das existenzielle Versteckspiel mit der eigenen Identität nicht nur unsererzwei Alteri Nos, sondern auch die Figuren von City of Glass. Ganz tief Luft holen, bitte:
Wir haben es bei der Vorlage mit einem Roman von Paul Auster zu tun, dessen Protagonist, Daniel Quinn, unter dem Pseudonym William Wilson Krimis über einen Privatdetektiv namens Max Work schreibt. Als ein mysteriöser Anrufer ihn für einen Privatdetektiv namens Paul Auster hält, beschließt Quinn, sich als diesen Auster auszugeben. Der Anrufer, den er bald persönlich kennenlernt, nennt sich einerseits Peter Stillman, behauptet andererseits aber im selben Atemzug, das sei nicht sein richtiger Name. Nichtsdestotrotz beauftragt er den vermeintlichen Privatdetektiv Auster, also Quinn, seinen Vater zu beschatten, der ebenfalls Peter Stillman heiße. Quinn, alias Auster, willigt ein, doch als er seine Zielperson zum ersten Mal sieht, muss er feststellen, dass es zwei ältere Peter Stillmans gibt, die mit dem gleichen Zug in New York ankommen. Quinn, alias Auster, entscheidet sich für einen der beiden. Nach einiger Zeit kommt Quinn, alias Auster, mit dem alten Stillman-Zwilling ins Gespräch, und er gibt sich dabei als „Quinn“ aus, weil er der Meinung ist, seine „Auster“-Identität vor Stillman schützen zu müssen. In zwei weiteren Gesprächen mit dem alten Stillman-Zwilling gibt sich Quinn, alias Auster, erst als „Henry Dark“ aus – eigentlich eine vom alten Stillman-Zwilling für einen Roman erdachte Figur, doch Quinn, alias Auster, behauptet, „ein anderer Henry Dark“ zu sein – und dann als „Peter Stillman“. Der alte Stillman-Zwilling akzeptiert das alles anstandslos. Quinn begegnet dann einem Autor namens Paul Auster, der, wie sich herausstellt, nichts mit dem ominösen Privatdetektiv Paul Auster zu tun, dafür aber einen Sohn hat, der Daniel heißt, genau wie Quinn selbst. Nach und nach wird Quinn dem alten Stillman nun immer ähnlicher, spricht nicht mehr, verwahrlost, verschwindet schließlich in der Dunkelheit. Und am Ende gibt sich noch ein anonymer Erzähler die Ehre, der sich schon vorher hier und da kaum merklich einmal eingeschaltet hat, und nun behauptet, mit Auster befreundet gewesen zu sein, über Quinns Verbleib aber nichts zu wissen.
Auster – der Autor des Romans City of Glass – treibt dieses Verwirrspiel in den beiden folgenden Teilen seiner New York Trilogy noch weiter auf die Spitze. Und in gewissem Sinne tut das auch Art Spiegelman, der Initiator der Adaption, in seinem Vorwort. Dort erklärt Spiegelman, wie er seinen ehemaligen Schüler Paul Karasik zu dem Projekt hinzuzog, nachdem David Mazzucchelli mit seinen Überlegungen in einer Sackgasse gelandet war. Und es stellte sich laut Spiegelman nicht nur heraus, dass Karasik Jahre zuvor bereits („zur Übung“) das erste Kapitel von City of Glass als Comic umgesetzt hatte, sondern auch, dass er Austers Sohn Daniel eine Zeit lang seinen Schüler nennen durfte.
Ob diese Geschichte stimmt oder nicht, sei dahingestellt (Karasik bestätigt sie), jedenfalls hätte Auster sich wohl keine bessere ausdenken können, wenn er das gewollt hätte. Spiegelman bringt das Ganze mit einem schönen Bild auf den Punkt: Es ist, als wäre Quinn am New Yorker Hauptbahnhof dem anderen Peter Stillman gefolgt.
1.
Und jetzt ans Eingemachte, Wederhake. Wie ich anfangs schrieb: City of Glass ist ein Witz.
Warum das so ist, lässt sich an seinen historischen Vorbildern festmachen. Da wäre zum einen The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, der einzige fertiggestellte Roman Edgar Allan Poes. Auster erwähnt das Buch in seinem Roman, und es lassen sich darin mehrere prägnante Parallelen zu City of Glass finden. Pym ist ein fiktives Reiseabenteuer, das als konventioneller Bildungsroman anfängt, danach jedoch zunehmend surrealer wird und sich am Ende nach einem furiosen Höllenritt mit Geisterschiffen, Kannibalen, einer bizarren Insel, einem noch bizarreren Endzeitszenario am Südpol und einem (mutmaßlichen) Sturz in die hohle Erde praktisch selbst verschlingt.
Der Leser bleibt mit dem abrupten Ende ratlos zurück, nicht zuletzt auch wegen eines verwirrenden Spiels mit den Identitäten der Figuren und des Autors. Das „Vorwort“ zu Arthur Gordon Pym ist mit „A.G. Pym“ unterzeichnet. Dieser Pym schreibt, er habe den Bericht seiner fantastischen Reise nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten dem Southern Literary Messenger angeboten – jenem Magazin, für das ein gewisser Edgar Allan Poe zu diesem Zeitpunkt geschrieben habe. Und weil seine Reise so unglaublich und er selbst zudem kein erfahrener Autor gewesen sei, so Pym, habe er Poe die ersten paar Kapitel schreiben und in in dem Magazin veröffentlichen lassen, und zwar „unter dem Deckmantel der Fiktion“. Aber der Messenger habe daraufhin Zuschriften von Lesern erhalten, die nicht glauben wollten, dass die Geschichte erfunden war. Und so habe sich Pym schließlich entschlossen, den Rest seiner Reise selbst aufzuschreiben.
Der Clou daran: Im Jahr 1837 hatte Poe tatsächlich die ersten Kapitel von Pym im Messenger veröffentlicht. Als sein Roman im folgenden Jahr erschien, nutzte er dieses Körnchen Wahrheit als Ausgangspunkt für einen irrwitzig verschachtelten Mummenschanz, der mit dem „Vorwort“ noch lange nicht zu Ende ist: Es gibt außerdem auch noch eine „Anmerkung“ am Ende des Romans, deren vermeintlich anonymer Verfasser von einem mysteriösen Unfall berichtet, bei dem Pym ums Leben gekommen sei, wobei auch „die zwei oder drei letzten Kapitel“ des Romans verloren gegangen seien. Ferner habe Poe, der womöglich über den tatsächlichen Ausgang von Pyms Reise bescheid wisse, die Auskunft darüber verweigert – auch darum, weil Poe selbst nie davon überzeugt gewesen sei, dass Pym die Wahrheit gesagt habe. Der Rest der kurzen „Anmerkung“ ergeht sich in Ansätzen zur Deutung dessen, was in den letzten Kapiteln des Romans beschrieben wird, die aber mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten.
Kurzum: Arthur Gordon Pym ist eine Art proto-postmoderner Roman, der mit der für Poe typischen Verspieltheit alle möglichen Genres (Bildungsroman, Abenteuer- und Schauergeschichten, Seemannsgarn, Reiseberichte) und Konventionen, die sich zu dieser Zeit großer Beliebtheit erfreuten, in teils abstruser Form auf die Spitze treibt und es am Ende dem Leser überlässt, sich einen Reim darauf zu machen. Poe vermischt Wahrheit und Fiktion noch schamloser, als es Auster in City of Glass tut, und er macht sich wie Auster zur Figur seiner eigenen Geschichte. Auch die „Buchstaben“, die Quinn in City of Glass in Stillmans Laufwegen durch die Stadt erkennen will, und die gezeichnet im Roman auftauchen, gehen auf Arthur Gordon Pym zurück. Dort sind es riesige, mannshohe Schriftzeichen, in denen sich Pym auf einer geheimnisvollen Insel wiederfindet – und wie in City of Glass sind sie auch in Arthur Gordon Pym als Zeichnungen vorhanden.
Das zweite große historische Vorbild Austers, das sowohl im Roman als auch im Comic diskutiert wird, ist Don Quixote. Auch hier haben wir’s wieder mit einer Parodie auf das vorherrschende Genre der Zeit zu tun: Ritterromane. Und auch hier macht der Autor sich einen Spaß daraus, seine vom Genuss zu vieler eben jener Ritterromane möglicherweise verblödeten Leser nach allen Regeln der Kunst an der Nase herumzuführen: Cervantes behauptet in Don Quixote, nicht er, sondern ein gewisser Cide Hamete Benengeli habe den Roman verfasst, und zwar auf Arabisch. Cervantes habe nur zufällig das Manuskript entdeckt und es ins Spanische übersetzen lassen; er wisse nicht, ob die Übersetzung korrekt sei, gibt sich aber dennoch überzeugt, dass Benengeli nichts als die Wahrheit geschrieben habe.
Die Szene in City of Glass, in der Quinn mit dem fiktiven Abbild Austers über Don Quixote spricht, ist auch eine zentrale Stelle des Comics (S. 92-94). Während der fiktive Auster mutmaßt, dass Cervantes eigentlich seinen Spaß an den parodierten Geschichten hatte und durch das Versteckspiel in Don Quixote seinen Mitmenschen einen unterhaltsamen Streich spielen wollte, bewegt sich die Perspektive über zwei Seiten und zwölf Panels hinweg langsam zum Fenster, dann zum Fenster hinaus und nach unten auf den Gehweg, wo ein Jo-Jo liegt, das schließlich von einer Hand aufgehoben wird. Und im nächsten Panel, dem ersten auf Seite 94, „schnellt“ die Perspektive abrupt auf Auster zurück, als der sich gerade süffisant zurücklehnt und Quinn – und dem Leser – die ganze Moral der Geschichte vor die Füße wirft: „Das ist doch am Ende alles, was man von einem Buch will … sich zu amüsieren.“
Im Roman ist die Stelle schon markant. Aber dadurch, dass Karasik und Mazzucchelli sie mit dem Jo-Jo verknüpfen – das in der Vorlage erst im Anschluss auftaucht, als Austers Sohn damit zur Tür hereinkommt – machen sie die Szene durch einen brillanten Kunstgriff auch visuell begreifbar: Wir haben es mit einem literarischen Spiel zu tun, das wie ein Jo-Jo funktioniert. Mal geht es hinunter, mal wieder hoch. Und im Mittelpunkt steht das Amüsement – des Lesers, aber gewiss auch des Autors.
In City of Glass bedient sich Auster dabei der Detektivgeschichte – womöglich eine weitere Verneigung vor Poe, der das Genre mit popularisiert hat –, ebenso, wie sich Poe und Cervantes zuvor der populären Genres ihrer jeweiligen Zeiten bedient hatten. Denn manchmal können wir der Angst um unsere eigene Existenz, der Angst vor der Dunkelheit, nur dadurch entkommen, dass wir uns Geschichten erzählen, die uns Rätsel aufgeben – Rätsel, aus denen wir vielleicht etwas lernen können, die uns aber in erster Linie zur Flucht verhelfen; und manchmal ist die Lösung dieser Rätsel gerade deshalb so schwer zu finden, weil sie so offen herumliegt wie der berühmte „entwendete Brief„.
Am Ende von Arthur Gordon Pym befindet sich der gleichnamige Held in „milchig-weißem“ Gewässer, ist von Ascheregen und weißem Dunst umgeben, sieht riesige weiße Vögel und eine umhüllte weiße Gestalt. Der Herausgeber des Southern Literary Messenger, mit dem sich Poe während der Entstehung seines Romans überworfen haben soll, hieß White. Wenn man das richtige Ende des Fadens findet, in Don Quixote, in Arthur Gordon Pym oder in City of Glass, und daran zieht, dann löst sich die Geschichte – im wahrsten Sinne – in Wohlgefallen auf. Karasik und Mazzucchelli haben aus diesem Faden ein verdammtes Jo-Jo gebaut.
Wie gesagt: City of Glass ist ein Witz.
Aber ein ziemlich guter.
0.
Bumm.
![]()
City of Glass: The Graphic Novel
von Paul Auster, Paul Karasik und David Mazzucchelli
Picador, 2004
Softcover, schwarzweiß, englisch, 140 Seiten, etwa 15,00 US-Dollar
ISBN: 978-0-312-42360-8
(Anmerkung: Es handelt sich um eine überarbeitete Version von Neon Lit: Paul Auster’s City of Glass, 1994.)
Die deutsche Ausgabe ist bei Reprodukt erschienen.
* * *
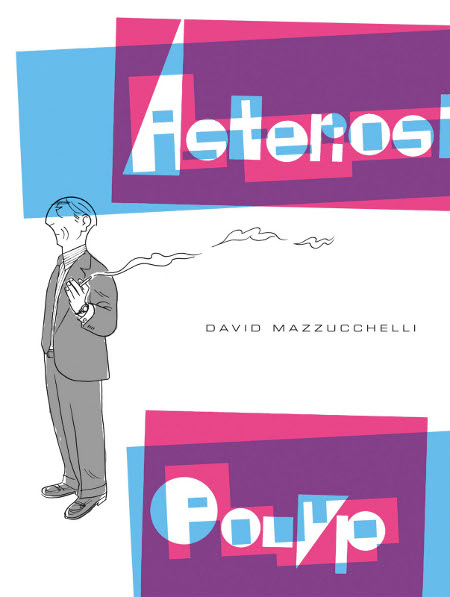
HIRSCH: Anders als ursprünglich geplant, kann M.-O. Fritsch Asterios Polyp an dieser Stelle leider nicht besprechen, deshalb springe ich ein. Ich heiße nicht wirklich Hirsch, Wederhake. Du kannst Hirsch zu mir sagen.
Außerdem möchte ich, der Spannung wegen, schon einmal darauf hinweisen, dass im 19. Absatz meiner Besprechung ein „aber“ kommt. („An den Leser denken.“)
Zu Beginn von Asterios Polyp schlägt der Blitz ein: Das Haus brennt, der gleichnamige Held des Comics muss sein stilvoll eingerichtetes, allerdings ziemlich verlottertes Apartment verlassen und in die verregnete Welt hinaus. Er sieht müde aus, dieser Asterios Polyp, wirkt eher passiv, und außer ein paar Dollar hat er nicht viel bei sich. Es ist der nicht ganz freiwillige Beginn seiner Reise zu sich selbst. Und während Asterios dorthin unterwegs ist, erfahren wir in Rückblenden, was bisher geschah.
Der Blitzschlag steht auch dafür, was den Leser rein visuell erwartet. Dass Mazzucchelli sich mit jedem seiner Hauptwerke neu erfindet, war schon vorher bekannt: „Born Again“ (in Daredevil, 1985/1986, mit Frank Miller) sieht anders aus als „Year One“ (in Batman, 1986/1987, ebenfalls mit Miller) sieht anders aus als City of Glass (1994, mit Paul Karasik und Paul Auster). Aber je länger Mazzucchelli für einen Comic Zeit hat, so scheint es, desto gravierender schlägt sich das in seinem Stil nieder. Anders gesagt: Man sieht Asterios Polyp die 15 Jahre an, die Mazzucchelli – erstmals auch als Autor – in dieses, sein viertes, großes Comic-Projekt investiert hat.
Und das schon, bevor man das Buch aufschlägt.
Asterios Polyp ist ein Architekt mit hermetisch-dialektischer Weltanschauung – ein hoffnungsloser Strukturalist, für den das Leben eine Ansammlung von Dualitäten und Gegensätzen ist. Das beeindruckende Formen- und Farbenspiel, mit dem Mazzucchelli dieses Thema im Buchinnern umsetzt, prägt auch das vom Autor selbst designte Äußere des Comics – den stylischen Schutzumschlag, den vorn und hinten mit Gravuren der Hauptfigur versehenen dicken Kartondeckel, selbst die Kapitalbändchen: oben blau, unten rot. Kurzum, Asterios Polyp sieht aus – und fühlt sich an – wie die Art von Buch-als-Kunstobjekt, die Asterios Polyp sich auf seinen Designer-Couchtisch legen würde.
Denn, wie M.-O. Fritsch schon zu City of Glass schreibt: Es kommt auf den Effekt an. Und Mazzucchelli ist jemand, der sich genaustens überlegt, was er sagen will, um es dann mit maximaler Konsequenz umzusetzen.
Im Innenteil liegt der optisch prägnanteste Unterschied zu City of Glass zunächst in der Offenheit des Seitenaufbaus. Während City of Glass sich auf beklemmende Weise ans Neun-Panel-Gitter klammert und seine Figuren in Gefängnisse aus dicken, schwarzen Tuschemauern sperrt, kommt Asterios Polyp hell und frisch daher. Die Seiten dieses Buches atmen, und Mazzucchellis Mut zu großzügig angelegten Freiflächen verleiht der Geschichte eine visuelle Dringlichkeit, die ganz unabhängig von der Handlung zum Weiterlesen ermuntert.
Schwarz findet man bei Asterios Polyp allein auf dem abnehmbaren Schutzumschlag; überall sonst sind sämtliche Linien und Texte in Blau, Rot oder Gelb gehalten – oder einer Mixtur daraus. Die Figuren selbst sind oft abstrakter als in Mazzucchellis früheren Arbeiten, wirken aber auf eine natürlichere und greifbarere Art lebendig.
Der visuelle Stil und die Bildsprache, mit der Mazzucchelli seine Geschichte vermittelt, werden ebenso methodisch etabliert wie die Figuren selbst. Die 13-seitige Anfangssequenz beginnt – wie alle nachfolgenden der insgesamt 22 Kapitel – mit einem zentrierten Bild auf einer ansonsten weißen Seite. Es folgen fünf relativ konventionelle Seiten mit je einem bis drei Panels in Blau und Violett, dann die Splashseite mit dem Einschlag des Blitzes, der Statik, Geometrie und Seitenaufbau durcheinanderwirbelt und – mit den Flammen und dem Erklingen des Rauchmelders – die Farbe Gelb einführt.
Der klar als Rot erkennbare Teil des Farbspektrums taucht in Reinform erst im vierten Kapitel auf, nach 38 Seiten, als Asterios – in einer Flashback-Montage – zuerst vorübergehend mit einer eher klecks- und schemenhaft dargestellten Studentin anbandelt, bevor, in einem Panel mit ungleich mehr Tiefenwirkung durch Kreuzschraffur, zum ersten Mal seine geschiedene Frau und große Liebe Hana Sonnenschein vollständig zu sehen ist. Richtig ausgeschöpft wird das Potenzial der drei Grundfarben und ihrer Mischmöglichkeiten erst im letzten Kapitel.
Mehr noch als bei City of Glass schreibt Mazzucchelli in Asterios Polyp mit Bildern und lässt Text visuell wirken. Und auch hier gibt es eine Vielzahl an Querverweisen. Das erste Kapitel mit dem Blitzeinschlag und dem Großstadt-Wohnhaus im strömenden Regen ist als Hommage an Eisner erkennbar; Asterios Polyp selbst geht locker als Paul Austers eineiiger Zwilling durch; Stanley Kubrick (Mann im Krankenbett, S. 44/45) und Fritz Lang (Abstieg in die „Unterstadt“, S. 243-263) lassen grüßen; und der ganze Comic ist ein Mosaik aus größeren und kleineren Bruchstücken griechischer Philosophien und Sagen – allein der Mythos von Orpheus und Eurydike wird zweimal durchdekliniert.
Seinen Namen verdankt Asterios Polyp wohl einerseits dem Kyklopen Polyphem, mit dem es einst Odysseus zu tun hatte – auch gelten Kyklopen in der Mythologie oft als Baumeister. Und andererseits der griechischen Sagengestalt Asterion, besser bekannt als Minotaurus. Jener haust bekanntlich in einem Labyrinth auf Kreta, bis er von einem gewissen Theseus zur Strecke gebracht wird. Theseus wiederum hat ein Schiff, das als Anschauungsobjekt eines philosophischen Gedankenspiels dient: Wenn man nach und nach alle Teile des Schiffes austauscht, ist es dann noch dasselbe Schiff?
Das Paradoxon wird indirekt im Comic thematisiert, als Gerry nach dem Konzert erklärt, die Zellen des menschlichen Körpers regenerierten sich alle sieben Jahre komplett, man sei also praktisch alle sieben Jahre „ein neuer Mensch“ (S. 270). Und nicht zufällig sind zu Beginn der Geschichte sieben Jahre vergangen, seit Asterios sich in Folge seiner Trennung von Hana aus dem Leben zurückgezogen hat (S. 292-294). Um sieben Ecken gedacht funktioniert Asterios Polyp demzufolge als Adaption des Minotaurus-Mythos.
Auch sonst ist Asterios Polyp ein beeindruckend ausgeklügelter Comic. Die von Hana vertretene Idee, dass sich durch die Beziehung zweier Dinge zueinander dazwischen zwangsläufig auch ein drittes ergibt, wird in der Geschichte immer wieder von allen möglichen Richtungen beleuchtet und ist bereits auf der vierten Seite doppelt präsent: einmal in Gestalt der zwei Türme von Asterios‘ Wohnhaus, deren Zwischenraum die gleiche Form erkennen lässt, bloß umgestülpt; und dann noch einmal innerhalb des linken Turms, wo nur in den beiden zu Asterios‘ Wohnung gehörenden, durch einen schmalen Mauerstreifen getrennten Fenstern Licht brennt.
Dieses Prinzip ist natürlich auch für die Erzählform Comic von tragender Bedeutung, wie wir spätestens seit Scott McCloud wissen: Wesentlich ist das, was zwischen den Kästchen geschieht. Konsequenterweise ist es dann auch dieser Raum zwischen den Panels, der sich in Form eines Blitzes ins Panel hinein verlängert, bevor er schließlich bei Asterios einschlägt und so die Geschichte in Gang setzt (S. 3/7). Asterios‘ Wohnung geht in Flammen auf – und zwingt ihn, eine Reise anzutreten, in deren Verlauf er mit seinem bei der Geburt verstorbenen Zwillingsbruder Ignazio seinen Frieden machen muss: Ignazio wie „Ignatius“ – Latein für „der Feurige“, versteht sich.
Auch dieser Faden lässt sich weiterspinnen: Wenn Ignazio für die italienische Herkunft von Asterios‘ Mutter steht, die Scherzkeks Mazzucchelli „Aglia Olio“ nennt, dann verkörpert Asterios die griechische Tradition seines Vaters Eugenios. Da passt es auch wieder irgendwie, dass Asterios‘ Weltbild sich im Laufe der Geschichte – während seines Aufenthalts in der fiktiven Kleinstadt „Apogee“, englisch für „Erdferne“ – zu einem wandelt, in dem er am Ende nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das geozentrische Weltbild der alten Griechen muss dem heliozentrischen des Italieners Galilei weichen, könnte man sagen.
Und so geht es immer und immer weiter, kann man nahezu jede Idee in Asterios Polyp aufgreifen, sie auf ihre historischen, etymologischen und theoretischen Hintergründe abklopfen und staunen, wie konsequent Mazzucchelli seine Geschichte durchdacht, wie präzise er sie durchkonstruiert hat, und mit welchem Elan Gedanken aus Mythologie, Astronomie, Architektur, Psychologie, Astrologie, usw. usf. aufgegriffen werden, um die Identitätskrise seines Helden zu beleuchten und zu bereichern.
Aber? Aber. Aber, aber, aber.
A-B-E-R:
Auch Mazzucchellis episch-kulturhistorische Schnitzeljagd täuscht nicht darüber hinweg, dass Asterios Polyp im Kern die stockkonservative Geschichte vom Selbstfindungstrip eines eigentlich ziemlich langweiligen weißen Alphamännchens ist, das seine Pseudonotlage allein dem eigenen Ennui zu verdanken hat. Es ist ein allenthalben spannend, oft grandios inszenierter Selbstfindungstrip, keine Frage. Der Eindruck, dass die eigentliche Story ihrer anspruchsvoll gewählten Form nicht gerecht wird, bleibt bestehen.
Das liegt vor allem daran, dass die Figur Hanas viel zu kurz kommt: eine bildende Künstlerin asiatischer Abstammung als weicher, organischer Gegenpart zum harten, rationalen Architekten alt-europäischer Herkunft, von dessen Entwürfen noch keiner umgestzt wurde? Blau steht für Asterios, Rot für Hana?
Klischeehafter geht’s nimmer.
Hana bleibt die ganze Geschichte über abhängig von Asterios, selbst nach der Trennung. Sie ist als Gegenstück zu Asterios konzipiert und definiert sich allein über ihn. Als eigenständige Figur wird sie nie greifbar. Was Hana und Asterios aneinander finden, bleibt ein Geheimnis, ebenso vage ist der Grund für ihre Scheidung.
Dass sie über sieben Jahre lang alleine herumsitzt und wartet, bis ihr arschiger Ex seine Midlife-Crisis überwunden hat, macht sie als Figur vor diesem Hintergrund vollkommen unglaubwürdig.
A-B-E-R:
Es handelt sich dabei natürlich um eine bewusste Versuchsanordnung. Solche gesellschaftlich konstruierten Gegensätze sind ja gerade das Thema des Comics, und auf der Theorie-Ebene setzt sich Asterios Polyp auch ständig mit ihnen auseinander.
Auch der Grundkonflikt zwischen Asterios und Hana wird in entsprechenden Szenen herausgearbeitet, die für sich genommen alle funktionieren: Asterios gefällt es nicht, wenn Hana im Mittelpunkt steht; offenbar will sie eine Familie gründen, er hingegen nicht (wenn ich die Szene mit dem Embryo-förmigen Tisch auf S. 154/155 – „Ich denke nicht in Dreier-Konstellationen.“ – richtig deute); Asterios macht auch keinerlei Anstalten, ihr irgendwie entgegenzukommen.
Und das Ende ist nicht weniger durchdacht und konsequent als der Rest des Comics: Einerseits lernt Asterios endlich, sich selbst nicht mehr als Mittelpunkt des Universums – „Ich bin der Held meiner eigenen Geschichte.“ (S. 276) – zu begreifen, sondern als „Nebenfigur in einer größeren Geschichte“ (S. 280/281), was ihn zu Hana zurückbringt und den beiden ein Happy End ermöglicht; andererseits ist und bleibt Asterios natürlich der Held der Geschichte, und daran lässt sich auch nichts ändern – das Buch trägt seinen Namen, alles dreht sich nach wie vor um ihn. Sämtliche Figuren, Hana inklusive, existieren nur aus einem einzigen Grund: als Katalysatoren für Asterios‘ Selbstfindung, die ja nun einmal der dramaturgische Gegenstand dieses Buchs ist.
Am Anfang (S. 34) heißt es: „Was, wenn die Realität (wie wir sie wahrnehmen) bloß eine Erweiterung unserer selbst wäre?“ Dass es so ist, scheint Asterios zu begreifen, als er – nach dem Zwischenfall beim Konzert – im Traum seinem Zwillingsbruder begegnet (S. 292). Danach ist der Erzähler, der andeutet, Ignazio zu sein, verschwunden – die beiden Zwillingsbrüder haben offenbar ihren Frieden miteinander gemacht.
Aber Asterios täuscht sich, denn Asterios Polyp, der Comic, ist selbstverständlich auch nur eine Erweiterung von Asterios Polyp, der Figur: Was die Welt dieser Geschichte angeht, bleibt Asterios die Hauptfigur – und damit der Himmelskörper mit der größten Masse und Anziehungskraft, um den sich alles dreht. Dass der Asteroid unaufhaltsam genau auf ihn zurast (und genau in der Mitte des Buches – nämlich auf den Seiten 172/173 von 346 – ein gewaltiges Loch hinterlässt, wie Douglas Wolk anmerkt), ist also nur konsequent – und wahrscheinlich ebenso unvermeidlich wie der Blitzeinschlag am Anfang. Wo sonst sollte der Blitz in Asterios Polyp auch einschlagen als bei Asterios Polyp?
Der freche, bitterböse Metagag, mit dem Mazzucchelli sich hier nach der ergreifenden Wiedervereinigung Asterios‘ mit Hana verabschiedet, funktioniert im Sinne des Themas, weil er in Mazzucchellis Konstruktion maximal konsequent ist.
A-B-E-R:
Auf der Figurenebene fordert dieser dramaturgische Kunstgriff eben seinen Tribut. Mazzucchelli verdient sich die Klischees nicht, mit denen er in seiner Geschichte hantiert, die aufwändig herbeikonstruierte Metapointe geht auf Hanas Kosten, die Handlungsebene und die Meta-Ebene werden nicht miteinander versöhnt. Das ist die Sollbruchstelle eines atemberaubend minutiös konstruierten, scharf beobachteten, sich seiner selbst bewussten literarischen Meisterwerks.
E-R-G-O:
Die Frage, die wir nasenbohrende Kunstrichter uns in unseren schlaflosen Nächten nun stellen müssen, lautet: Ist es das wert?
Hätte man Asterios Polyp überhaupt so konstruieren können, dass Hana als glaubwürdige Figur erscheint, ohne dabei die Kernaussage des Comics aus den Augen zu verlieren? Lohnt sich der ganze Aufwand für die Moral, dass die Moral unserer Geschichten mit aller Konsequenz auf uns zurückfallen wird, weil es eben unsere Geschichten sind?
Der Hirsch meint: ja/womöglich/auf jeden Fall.
![]()
* * *
WEDERHAKE: Bis auf die das Gesamtwerk rückwirkend schwächende, doofe, wenn auch von langer Hand vorbereitete dramatische Ironie am Ende echt toll.
![]()
Asterios Polyp
von David Mazzucchelli
Pantheon, 2009
Hardcover, farbig, englisch, 340 Seiten, 29,95 US-Dollar
ISBN: 978-0-307-37732-6
Die deutsche Ausgabe ist bei Eichborn erschienen und wurde bei Comicgate hier besprochen.
Abbildungen: © Mazzucchelli/Picador und Mazzucchelli/Pantheon
