Aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen: Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Die Comicgate-Redakteure Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: Journalism von Joe Sacco und Chroniques de Jérusalem von Guy Delisle.
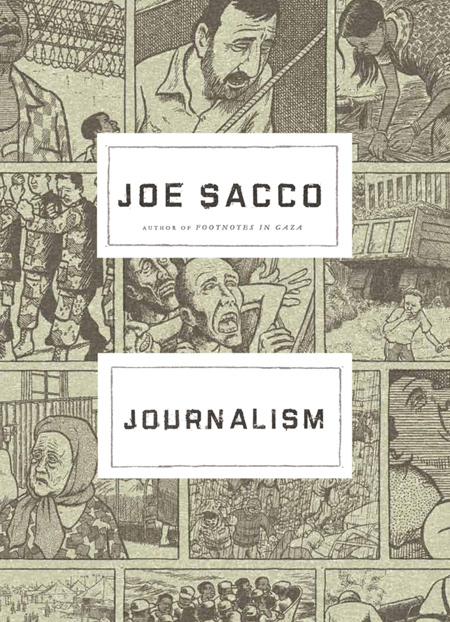
FRISCH: Journalism. Zack. Wie viele Comic-Zeichner können ein Buch herausbringen, auf dessen Deckel einfach nur „Journalismus“ steht? Der erste, der mir einfällt, ist Joe Sacco. Dass er es tatsächlich macht, zeugt von Selbstbewusstsein. Das ist erfreulich. Noch erfreulicher ist, dass Sacco diese Sammlung von Reportagen aus den Jahren 1998 bis 2011 trotzdem zum Anlass nimmt, sich in seinem Vorwort grundsätzlich zu erklären: hier die inhärent subjektive Arbeit des Cartoonisten, dort das nach Objektivität verlangende Handwerk des Journalisten – lässt sich das miteinander vereinbaren?
Das geht schon bei der Erwägung los, was eigentlich gezeichnet werden soll. Denn anders als eine Fotografie oder ein Film fängt eine Zeichnung keine visuellen Details „automatisch“ ein. Und anders als reine Prosa kann der Comic visuelle Details nicht einfach der Fantasie des Lesers überlassen. Die Darstellung in Saccos Comics beinhaltet nur genau das, was er selbst hineinzeichnet. Jeder Strich ist das Resultat einer subjektiven Entscheidung. Um dennoch das zu erreichen, was er „bildliche Wahrhaftigkeit“ nennt, unterscheidet Sacco zwischen „konkreter Wahrheit“ und „essenzieller Wahrheit“. Ein Cartoonist, so Sacco, orientiere sich an Letzterem, was ihm – unabhängig von der Art seines Zeichenstils – eine subjektive Interpretation der Wirklichkeit zugestehe. (Und das ist, wie in unserer Besprechung von Kleists Boxer erwähnt, vom Prinzip her ja gar nicht so weit weg von der Philosophie eines Dokumentarfilmers.)
Immer wieder hebt Sacco dabei die Wichtigkeit der Fakten hervor, beschreibt seine gezielten Nachfragen nach allen möglichen visuellen Details bei Augenzeugenberichten, betont seine Überzeugung, alles so wirklichkeitsgetreu wie möglich darstellen zu müssen. In der Tat: Gerade die visuellen Details sind es, die Saccos Berichterstattung lebendig werden lassen und den dargestellten Szenen eine in Comics selten spürbare Intensität verleihen: der Zigarettenqualm eines mutmaßlichen serbischen Kriegsverbrechers beim Gespräch mit einem Journalisten; die Brosche am bizarr überdimensionalen Hemdkragen eines maltesischen Nationalisten; die Muster der Decken und Teppiche, die tschetschenische Flüchtlinge in ihren klammen, erbärmlich maroden Notunterkünften aufgehängt haben; der opulente Fingerschmuck eines Verwaltungsbeamten in der indischen Provinz, der von den vielen Programmen schwärmt, die nominell zum Wohle der völlig verarmten Dorfbewohner dort existieren. Es sind unzählige Details wie diese, die mir als Leser das Glauben und Begreifen des Gezeigten ermöglichen.
Sacco weist auch darauf hin, dass Faktentreue und Subjektivität sich nicht ausschließen. Er empfinde es als befreiend, schreibt er, sich selbst als aktiven Teilnehmer des Geschehens in seinen Geschichten darstellen zu können, denn es entbinde ihn von dem Zwang, so zu tun, als habe seine Präsenz als Reporter keine Auswirkungen auf die Menschen und Ereignisse, über die er berichtet.
Diese befreiende Wirkung bleibt einem als Leser nicht verborgen. Sacco zeichnet sich im Internationalen Gerichtshof in Den Haag, zwischen den Ruinen palästinensischer Häuser im Gazastreifen oder in einem Flüchtlingslager in Inguschetien. Man sieht ihn im Gespräch mit israelischen Soldaten, afrikanischen Flüchtlingen und irakischen Folteropfern. Und er nutzt solche Gelegenheiten, um offenzulegen, welche Hoffnungen und Ängste seine schiere Anwesenheit bei seinen Gesprächspartnern und in ihrem Umfeld auslösen kann. Natürlich gehört auch das ständige eigene Auftreten zu Saccos subjektiver Darstellung. Aber jene Reflexivität hat eben, in bester Tradition Norman Mailers und Hunter S. Thompsons, auch den im Sinne der journalistischen Transparenz wünschenswerten Nebeneffekt, den Leser mit der Nase auf die gegebene Subjektivität zu stoßen.
Schlagwörtern wie „Objektivität“ oder „Ausgewogenheit“ steht Sacco indes misstrauisch gegenüber. Ein Reporter könne schließlich nicht aus seiner Haut, argumentiert er, könne die Weltanschauung, die sich aus seinem eigenen kulturellen und sozialen Hintergrund ergebe, nicht einfach abstreifen, um wahrhaft „objektiv“ zu werden. Und ein Journalist, so Sacco weiter, solle auch nicht glauben, im Sinne der Ausgewogenheit darauf verzichten zu dürfen, die Aussagen gegnerischer Seiten auf ihren jeweiligen Wahrheitsgehalt zu überprüfen und für sein Publikum entsprechend einzuordnen. „Die Wahrheit liegt in der Mitte“? Oft ein gefährlicher Fehlschluss, findet Sacco. „Ausgewogenheit sollte kein Deckmantel für Nachlässigkeit sein. […] Ziel des Journalisten muss es sein, herauszufinden und zu berichten, was geschieht, und nicht, die Wahrheit im Namen der Gleichbehandlung zu kastrieren.“
Der von Sacco offen formulierte Anspruch, die Sorgen und Entbehrungen notleidender Menschen nicht mit – wie er es nennt – der „geschickten Apologetik der Mächtigen“ aufwiegen zu müssen, ist zumindest diskussionswürdig. Sicher: Es schockiert, wenn er berichtet, wie beiläufig die Häuser palästinensischer Familien von Israel zerstört werden, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge in Malta oder Inguschetien hausen müssen, oder dass Dalit-Familien in Indien darauf angewiesen sind, ihre Nahrung von den Ratten zurückzustehlen, um nicht zu verhungern. Und soweit ich es beurteilen kann, ist Sacco auch nicht vorzuwerfen, er würde Fakten verzerren oder außer Acht lassen, oder er würde nicht alle Seiten anhören und ihre Aussagen entsprechend gegenrecherchieren.
Aber Sacco ergreift eben Partei für die Schwachen – oder die, die er dafür hält. Er kündigt das im Vorwort an, und es schlägt auch in seinen Reportagen unübersehbar durch. „Reporter sollten neutral und unvoreingenommen für jene eintreten, die leiden“, zitiert er den englischen Journalisten Robert Fisk. Daran ist auf den ersten Blick wenig auszusetzen. Doch leider sind die Schwachen und die Leidenden nicht immer eindeutig identifizier- und von den Starken und Mächtigen trennbar. Und – das wird etwa im Nahostkonflikt oder auf Malta deutlich – die Tatsache, dass eine Seite leidet, muss auch nicht bedeuten, dass die andere Seite zwangsläufig im Unrecht ist oder den Konflikt durch anderes Verhalten gegenüber den Notleidenden lösen könnte.
Das weiß natürlich auch Sacco, bei aller Anteilnahme für die Betroffenen der Konflikte, über die er berichtet. Und er weiß ebenso um die schlichte Unmöglichkeit, all die Widersprüche, die sich aus seiner Berichterstattung ergeben, vollständig auflösen zu können: einerseits die Verpflichtung gegenüber der Wahrheit und das Streben nach bestmöglicher Faktentreue, im Großen wie im Kleinen; andererseits die zutiefst subjektiven Sympathien, Interpretationen und Entscheidungen des Berichterstatters. Lässt sich das miteinander vereinbaren? Nein, aber man muss es trotzdem versuchen, und man muss dabei bestmöglich über die sich ergebenden Widersprüche des eigenen Tuns aufklären.
Das ist die Antwort, die Journalism gibt, und das Buch lässt schließlich auch erahnen, dass vielleicht gerade ein Comic – vielleicht mehr noch als Film, Fotografie oder Prosa – in der Lage sein könnte, diesem Anspruch bestmöglich gerecht zu werden.
Hab ich was übersehen, Wederhake?
![]()
***
WEDERHAKE: Übersehen nicht, Frisch, aber wohl anders gewertet als ich. Denn es ist genau der Teil mit der Chimäre „Ausgewogenheit“, an dem Sacco und Journalism für mich straucheln. Sacco sieht sich, wie du schon sagst, als jemand, der denen in der Welt eine Stimme gibt, die diese Stimme sonst nicht besitzen: Displaced Persons aus Tschetschenien, die Unberührbaren in der indischen Provinz, Flüchtlinge auf Malta, palästinensiche Familien in der West Bank. Sacco ist interessiert an den einfachen Menschen, nicht den Politikern oder Soldaten. Und er verzichtet darauf, den Mächtigen den gleichen Raum wie den Schwachen zu bieten, da die Mächtigen „von den Mainstream-Medien und den Propagandaorganen“ schon hervorragend bedient würden. Aber davon bin ich noch nicht in jedem Fall überzeugt. Besonders, weil nicht immer klar ist, wer denn nun überhaupt die Mächtigen sind.
Nimm zum Beispiel seine Reportage aus Hebron, die mir beim Lesen ein wenig zu einseitig vorkam, da Sacco verschiedene palästinensische Familien zu Wort kommen lässt, die jüdische Perspektive aber nur von einem ultra-orthodoxen Siedler vertreten wird. Womit sich die Frage stellt, ob denn die jüdischen Siedler in der West Bank tatsächlich schon die Mächtigen sind, denen Sacco nicht dienen will. (Oder ob der Kriegsverbrecher in Den Haag noch zu den Mächtigen gehört, jetzt wo er vor Gericht steht.) Und im Nachwort zu diesem Teil erklärt Sacco sogar noch, dass er den Text heute als missglückt empfinde, weil er noch zu sehr der Idee der Ausgewogenheit nachgehangen habe, die ihm im Journalismusstudium eingebläut wurde.
Wirklich aufgefallen ist es mir aber in seiner Reportage über Flüchtlinge aus Malta, die für mich das Kunststück vollbracht hat, gleichzeitig das beste Kapitel in Journalism und trotzdem stellenweise arg problematisch zu sein. Sacco selbst ist hier zufrieden mit der Balance, die er gefunden hat: Er stelle das Leiden und das Elend der Flüchtlinge dar, die ganz eindeutig seine Sympathien haben, lasse aber auch die Malteser mit ihren Sorgen und Nöten ernsthaft zu Wort kommen. Aber das Gefühl hatte ich beim Lesen nicht. Es mag durchaus sein, dass das Stimmungsbild, das Sacco hier einfängt, den tatsächlichen Begebenheiten entspricht. Von den weißen Maltesern, die hier für VoxPops herhalten, gibt es nur einen, der so etwas wie Verständnis oder sogar Sympathie für die Flüchtlinge aufbringt, der Rest ergeht sich einfach darin, ein rassistisches Stereotyp nach dem anderen über West- und Ostafrikaner und ihre Lebensweise herunterzubeten. Einige der übelsten Sätze werden im Panel nochmal dadurch unterstrichen, dass sich weiße „Blitze“ explosionsartig vom Kopf des Sprechers wegbewegen und den ansonsten völlig schwarzen Hintergrund aufbrechen. Zugleich werden dadurch aber auch meiner Ansicht nach legitime Sorgen – etwa die Frage, wieviel Gewicht organisierte Kriminalität in zunehmend größer werdenden Flüchtlingslagern spielt, wenn der Staat hier kein Interesse an Kontrolle hat – in diesem Kontext eines Dauerfeuers an rassistischen Vorurteilen zu schnell weggewischt oder vom Leser mental in die selbe Kategorie eingeordnet. Sacco hat natürlich Recht, diese Sorgen kann man in den großen Tageszeitungen lesen, und er hat natürlich das Recht, hier vorrangig den Flüchtlingen eine Stimme zu geben; aber gerade in dieser Passage scheint mir die Problematik des unvoreingenommenen Eintretens für die Leidenden seine Schwachstellen zu zeigen.
Journalism. Zack? Nach dem Lesen dieses Buches würde ich – der von Sacco ja kritisch hinterfragten Ausgewogenheit wegen – eher zu „Journalism & Essayism“ tendieren, denn Teile der hier zu findenden Werke sind eindeutig Kommentare, so wie die letzte Seite seines Tschetschenien-Berichts, auf der er ganz offen, direkt und sarkastisch die Situation der Flüchtlinge darstellt, um Wladimir Putins Erfolgspropaganda zu konterkarieren.
Jenseits dieser Elemente pflichte ich dir aber wieder bei, Frisch: Was Joe Sacco hier vorlegt, sind hochrelevante Arbeiten, die deutlich machen, welche Rolle Comics im journalistisch-essayistischen Bereich jenseits politischer Karikaturen spielen können. An einer Stelle greift Sacco sogar etwas aus Zeitungen des 19. Jahrhunderts auf, wenn er ganzseitige Bilder der Occupied Territories zeichnet, die man heute eigentlich der Fotoreportage überlassen würde. Das sind natürlich komponierte Stimmungsbilder, aber bei den Zeichnungen ist uns das zumindest bewusst, während Fotos – trotz Photoshop, trotz über eines Jahrhunderts der Manipulation – immer noch eine nicht existierende Objektivität vorgaukeln.
Da Journalism Saccos Arbeiten aus fast fünfzehn Jahren und für verschiedenste Organe sammelt, wird deutlich, wie sehr Sacco sein Handwerk perfektioniert hat, aber auch, wie abhängig er davon ist, Raum zu erhalten. Sein Bericht über das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag (übrigens auch weniger Reportage und eher allegorischer Kommentar über die Verantwortung der westlichen Welt, die im Bürgerkrieg in Jugoslawien nicht eingriff) und seine Reportage aus Hebron leiden noch darunter, dass sie wie ein „bebilderter Text“ wirken und teilweise sogar ohne die Bilder als Fließtext funktionieren würden. Was auch daran liegt, dass Sacco hier auf eng abgesteckter Seitenzahl arbeiten musste. Für die folgenden Arbeiten hatte Sacco dann mehr Raum zugesprochen bekommen und profitiert davon. Sacco verwendet ab der dritten Sektion des Buches verschiedenste Stilmittel: Ganzseitige Darstellungen der Verzweiflung, größere Panels, die die Einsamkeit einer Frau in ihrer Unterkunft hervorheben, der Zoom auf die Augen eines von der Folter in den Wahnsinn getriebenen Flüchtlings, eine Seite mit statischer Kamera, die unnachgiebig und unablässig auf das Gesicht der erzählenden Frau hält, auch wenn diese zwischendrin in einem wortlosen Panel in Tränen ausbricht. Hätte Claude Lanzmann seine Shoah in Comicform abgeliefert, er hätte so gearbeitet. Ein Photo, das dieser Frau so unglaublich wichtig ist, zeigt Sacco derweil nicht. Es ist für ihn „nur ein Foto“. Die emotionale Bedeutung des Bildes liegt im Auge der Betrachterin, weder Sacco noch wir könnten den Wert verstehen. Das tatsächliche Bild nicht zu zeigen, damit aber den Abzug als greifbares Objekt zu universalisieren, zeigt, wie groß Saccos handwerkliches Repertoire ist.
Ohnehin beginnt Sacco ab dem dritten Teil wirkliche Comic-Reportage zu betreiben, nicht nur einen Fließtext zu bebildern: sequentielle Sequenzen zu nutzen, seinen Bildern auch ohne begleitenden Text Aussagekraft zuzugestehen, seine Reportage mit einem Cold open zu beginnen, Elemente zu kontrastieren (so stellt Sacco etwa in „Trauma“ die Geschichte der vermutlich misshandelten Iraker der medialen Aufbereitung ihrer Geschichte in Washington D.C. gegenüber).
Sacco hat mit dem Blick auf die Marginalisierten eine Nische gefunden, in der er sehr gut arbeitet. Das macht für mich gerade seine erste Irak-Reportage sehr interessant, in der er als „embedded journalist“ für den Guardian gezwungen ist, seine Nische zu verlassen, und über amerikanische Soldaten berichten muss, während ihm der Kontakt zum einfachen Volk verwehrt bleibt. Und obwohl Sacco vereinzelt Einblicke in das Innenleben der Soldaten und deren Schwierigkeiten bietet, merkt man der Geschichte an, dass es nicht Saccos Metier ist, dass er lieber über etwas anderes berichten würde. Über einfache Menschen. „Complacency Kills“ wird so zu einem der schwächsten Beiträge in Journalism. Konsequenterweise berichtet er in der zweiten Irak-Reportage von einfachen Irakern, die im Sgt.-Hartman-Stil für den Dienst in der irakischen Nationalgarde ausgebildet werden und abschließend von zwei Irakern, die wegen der ihnen widerfahrenen Menschenrechtsverletzungen gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld klagen. Und beide Reportagen funktionieren sofort deutlich besser, was ich fast schon bedauerlich finde, weil ich von Sacco gerne mehr Reportagen sehen würde, die ihn aus seiner Routine herauszwingen.
Letztlich muss ich aber auch konstatieren, dass mein Wunsch hier völlig sekundärrelevant ist, denn seine Routine – im U-Comix-Stil, mit schiefen Captions und schiefen Panelrändern von den Marginalisierten zu berichten – hat Sacco inzwischen so weit perfektioniert, dass er, sofern er den Raum dafür erhält und es ihm nicht kaputt-koloriert wird, seinen Lesern ungeschönt und unnachgiebig die Lebensbedingungen und inneren Traumata jener aufzeigt, die wir ansonsten gerne ignorieren. Ich gebe zu, weder über die Flüchtlinge auf Malta, noch die tschetschenischen Frauen, noch die Unberührbaren in Indien habe ich vor Journalism jemals wirklich nachgedacht. Das überwiegt meine Gedanken zu den Schwächen seiner gezielten „Nicht-Neutralität“ bei Weitem. Sacco leistet einen öffentlichen Dienst wie derzeit kein zweiter im Comicbereich und dafür gebührt ihm großer Respekt.
![]()
Journalism
von Joe Sacco
Metropolitan Books, 2012
Hardcover, teilweise farbig, englisch, 190 Seiten, 29,00 USD
ISBN: 978-0-8050-9486-2
***
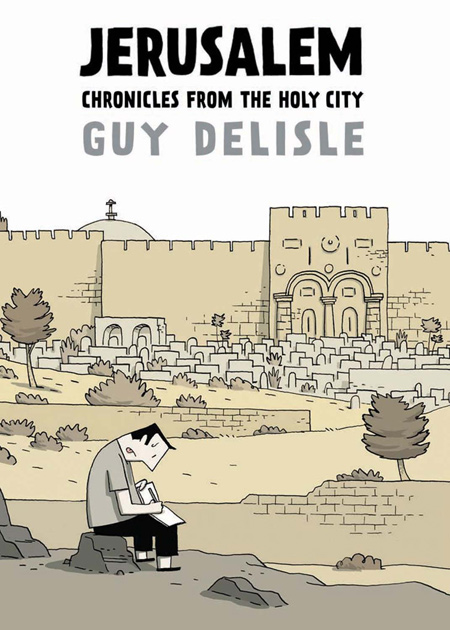
WEDERHAKE: Journalism. Zack. Bei Sacco ist’s einfach, da steht’s ja schon auf der Dose. Aber was macht eigentlich Guy Delisle, Frisch? Der hat uns ja schon mit seinen Aufzeichnungen aus Shenzen und Pjöngjang Einblicke in teils völlig fremde Kulturen geboten, arbeitet aber eindeutig weder als Journalist noch als Essayist. Chronicles from the Holy City klingt nach Chronist, aber das trifft es ebenso wenig richtig wie das sperrige „Memoirist“, das der Verlag auf der Rückseite des Buches verwendet. Und über das Kochalka’sche Comic-Tagebuch geht er auch hinaus. Aber eben nicht immer. Dann wiederum: Muss wirklich alles fein säuberlich in eine Schublade passen?
Die Vielschubladigkeit des Werkes kann, je nach Betrachter, Stärke oder Schwäche sein: Wer auf Einblicke in den Alltag im Nahen Osten Wert legt, der ist vielleicht nicht so angetan von den untergemischten politisch-historischen Grundlagen. Wer auf politische Einsichten hofft, der mag von Delisles konstanter Suche nach Spielplätzen für seine Kinder gelangweilt sein. Und wer auf besagtes Kochalka’sches Comic-Tagebuch baut, dem gefällt sicher die Seite, auf der Delisle über sein Lieblingsmüsli schwadroniert, den wird der ganze Rest aber nicht begeistern. Eine zusätzliche Hürde ist auch, dass Delisle hier nicht mehr aus einem Land berichtet, das der Mehrheit der Leser völlig fremd ist: Seien wir ehrlich, Frisch, wieviel wussten und wissen wir schon von verschlossenen Staaten wie Myanmar, Nordkorea oder China in seinen Sonderbewirtschaftungszonen? Aber Israel? Das konstant in den Nachrichten ist? Was will uns dieser Frankokanadier da noch Neues erzählen?
Mit all dem aus dem Weg: Für mich persönlich funktioniert Jerusalem wirklich gut; was auch daran liegt, dass ich die Art mag, wie sich Delisle hier als völlig unbeleckter Naivling gibt, der scheinbar bis vor kurzem nicht einmal wusste, dass es so etwas wie einen Nahen Osten gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Lesern sauer aufstößt, an einigen Stellen wirkt es zu konstruiert und in gewissen Momenten wirkt es geradezu arrogant. Aber die Art, wie sich Delisle Columbo-haft durch Israel tölpelt, fand ich durchaus sympathisch und auch zu seinem naiven, sehr abstrahierenden Zeichenstil passend.
Delisle mixt, wie schon gesagt, Familienberichte (endlich eingeschlafenes Kind wird vom Muezzin geweckt) und Anekdoten (Hochzeit, bei der keine Frauen anwesend sind und Männer mit Männern tanzen) mit Teilen, die den Leser über Geschichte, Politik oder Religion in Israel informieren, ohne dabei in ihrer informierenden Art aufdringlich zu sein. Ich nutze mal das schwer vorbelastete Wort „Edutainment“.
Das Schöne an Jerusalem ist, dass Delisle ein guter Anekdoten-Erzähler ist, der mich auch bei den belanglosen Parts nicht langweilt. Die Geschichte, in der er erzählt, wie er mit einem Kleiderbügel seine Schlüssel aus dem Aufzugsschacht fischt (und dabei das Verb „macGyvern“ verwendet), hat mich beim Lesen lachen lassen. Und auch in ernsteren Momenten behält Delisles Erzählung meist ihren humorvollen Unterton, egal ob er von einem Zeichenworkshop berichtet, bei dem Teilnehmer aus religiösen Gründen das Zeichnen von Menschen ablehnen, von Hellsing lesenden Pfarrern, der Normalität aller Beteiligten, wenn ein israelischer Checkpoint mit Steinen beworfen wird, oder von einem Moment des Zögerns, als er einen Apfel mampfend im Ramadan durch die Straßen zieht. Daraus hervor geht das vielleicht größte Lob, das ich Delisle für Jerusalem aussprechen kann: Dass er es schafft, einen Comic aus und über Nahost vorzulegen, der charmant und unaufgeregt daherkommt.
Jerusalem ist Delisles bisher längstes Werk und gerät gelegentlich ins Territorium des selbstgefälligen Abschweifens. Entweder, weil ihm ein durchsetzungsfähiger Redakteur fehlte oder, weil Jerusalem kein Leitmotiv hat, das die Einzelelemente verbindet, wie es der Papierflieger in Pjöngjang schaffte. Gleichzeitig nutzt Delisle die über 300 Seiten aber auch für formale Experimente, die er sich bei einer knapperen Erzählung vielleicht nicht trauen würde: Einmal passiert er einen israelischen Checkpoint zu Fuß und stellt das in einigen Panels wortlos aus der ersten Person dar, was ich als sehr beklemmend empfand. Auch die Art, wie er Zitate markiert, finde ich im Vergleich mit Joe Sacco interessant: Wir sehen unten am Panelrand einen Teil des Kopfes des Erzählers und das erzählte Element in die von diesem Kopf ausgehende Sprechblase gezeichnet. Der Umstand, dass wir es nicht mit Delisles Erfahrungen, sondern mit einer Erzählung zu tun haben, ist somit visuell immer präsent. Eine spannende Idee. Und sein gebrochenes Hebräisch durch völlig verkrickelte hebräische Lettern zu symbolisieren, ist simpel aber smart. Handwerklich ist Jerusalem längst nicht so schlicht, wie es auf den ersten Blick wirken mag.
Einzig die Monate des Gaza-Krieges fallen mir hier negativ auf: Der Ton des Comics wird ernster, aber Delisles Alter Ego behält seine völlige Naivität, die in dieser Situation auf einmal nicht mehr charmant sondern dekadent wirkt. Allerdings würde ein plötzlicher Bruch mit seinem Alter Ego (in der Branche nennen wir das: einen Spiegelman-beim-Psychologen abziehen) vermutlich noch weniger funktionieren. Außerhalb dieser Passage hat mich die Erzählweise nämlich völlig bei der Stange gehalten: Jerusalem schafft es selbst nach 300 Seiten noch, mir neue Seiten an Israel nahe zu bringen und mich zu überraschen, egal ob mit Kleinigkeiten wie den Spider-Man-Kippas, mit Absonderlichkeiten wie den roten Färsen (die mir aus Michael Chabons The Yiddish Policemen’s Union noch hätten bekannt sein sollen) oder mit größeren Momenten wie dem Purim-Besäufnis der orthodoxen Juden.
Es ist ein politisches Werk, weil jedes Werk über den Nahen Osten automatisch politisch wird, das versucht, nicht politisch zu sein (obwohl Delisle versucht, einen Workshopteilnehmer zum Zeichnen politischer Comics zu bewegen), sondern stattdessen einfach nur einen kaleidoskopartigen Blick auf das Alltagsleben in einem völlig fragmentarisierten Land zu werfen. Und auf der Ebene ist Jerusalem wirklich gelungen.
Es mag nicht Joe Sacco sein, aber – wie Delisle in einem Scherz auf Seite 301 selbst anmerkt – das ist auch gar nicht seine Absicht.
![]()
Jerusalem: Chronicles from the Holy City
von Guy Delisle
aus dem kanadischen Französisch von Helge Dascher
Drawn & Quarterly, 2012
Hardcover, farbig, englisch, 330 Seiten, 24,95 USD
ISBN: 978-1-7704-6071-3
***
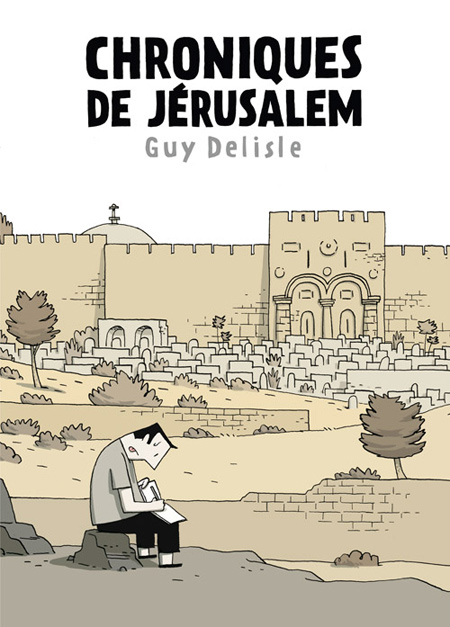
FRISCH: Was macht Delisle? Delisle macht Reiseberichte, Wederhake. Und gerade Jerusalem ist, nicht zuletzt dank der Kreuzzüge, eigentlich das Ziel schlechthin, was dieses Genre anbelangt. Tausende von Kreuzfahrern waren in Jerusalem. Marco Polo war in Jerusalem. Ida Pfeiffer war in Jerusalem, und Saul Bellow war in Jerusalem. Die Comicmacher Joe Sacco, Sarah Glidden und Maximilien Le Roy? Waren in Jerusalem. Sogar ich war in Jerusalem.
Und Guy Delisle war auch in Jerusalem, und im Gegensatz zu mir hat er ein Buch daraus gemacht. Ich gehöre nämlich offenbar zu den wenigen Menschen, die in Jerusalem waren und kein Buch daraus gemacht haben, Wederhake, und ich muss sagen: Ich stehe nach wie vor zu dieser Entscheidung. Nicht, dass es in Israel nicht viel zu erleben gäbe. Der Blick auf die Hafenstadt Haifa. Das Wadi David in seiner paradiesischen Schönheit. Die schwindelerregende Wüstenfestung Masada. Von den kulturellen, kommerziellen und religiösen Eindrücken, die in einer Stadt wie Jerusalem wirken, einmal ganz abgesehen.
Aber ich war ja nicht lange dort, und so toll es damals war, mit Taxifahrern um ein paar Schekel zu feilschen, weibliche Mitreisende in Kamele umrechnen zu lassen, in einem arabischen Viertel größere Mengen Bier zu suchen (und zu finden) oder in Gotteshäusern, die man nicht in kurzen Hosen betreten darf, „Heilige Marmelade“ kaufen zu können, sollte man doch nicht vergessen: So ein Buch hat ziemlich viele Seiten.
Guy Delisles Buch, zum Beispiel, ist auch so eins mit ziemlich vielen Seiten. Das muss kein Problem sein, denn Israel ist ein geschichtsträchtiges Land, Jerusalem einer der reichsten, bewegtesten und wichtigsten Schauplätze westlicher Kultur.
Wie du nun richtig anmerkst, Wederhake, ist Delisle nicht Sacco, und das ist auch gut so. Sacco ist Krisenberichterstatter. Er sucht sich gezielt Orte aus, an denen viel im Argen liegt, und er begibt sich dorthin, um von direkt betroffenen Menschen Dinge zu erfahren, die er dann in seinen Comic-Reportagen journalistisch, politisch und literarisch aufbereitet.
Delisle hingegen ist einfach Tourist, und daraus macht er gar keinen Hehl. Nach Jerusalem verschlägt es ihn, weil seine Frau beruflich ein Jahr lang dort zu tun hat. Delisles Chroniques de Jérusalem, so der Original-Titel, ist eben ein streng chronologischer, nach Monaten sortierter Bericht dessen, was Delisle während dieser Zeit in Israel gesehen und erlebt hat.
Auch das muss nicht verkehrt sein. Jeder Mensch bringt eine eigene Perspektive mit, die selbst dem hunderttausendsten Buch über ein Land, eine Region, eine Stadt noch zu lesenswerten und faszinierenden Erkenntnissen verhelfen kann. Allein die gewaltigen menschlichen Abgründe, die sich im Nahen Osten immer wieder auftun – ein Blick in die Nachrichten genügt dieser Tage wieder –, bieten jemandem, dem ernsthaft an Beobachtung und Kontemplation gelegen ist, mehr als genügend Stoff.
Und gelegentlich lässt Chroniques auch eine Ahnung dessen aufflackern, was es hätte sein können. In einer der besten Szenen, nach etwa 50 Seiten, entdeckt Delisles gezeichnetes Alter Ego seine Lieblingsfrühstücksflocken in einem Supermarkt. Weil der Laden sich in einem von Israel nach internationalem Recht illegal annektierten Bereich Jerusalems befindet, entschließt sich Delisle schweren Herzens, ihn zu boykottieren, nur um draußen überrascht festzustellen, dass ein paar muslimische Frauen überhaupt kein Problem damit haben, dort einzukaufen.
Es ist eine schöne Anekdote, die vieles auf den Punkt bringt: den Fakt der völkerrechtswidrigen israelischen Besetzungen, die Schwierigkeit des internationalen Umgangs mit dem Nahostkonflikt und der konkrete, offenbar frappierend pragmatische Lebensalltag vor Ort. Ein weiteres Highlight, vor allem erzählerischer Natur, ist die von dir bereits erwähnte Szene, in der Delisle den Checkpoint zu Fuß passiert.
Solche Stellen kommen also vor. Doch leider sind sie nur traurige Croutons in einer schwachen Suppe aus überdehnten Belanglosigkeiten in der Endlosschleife, weichgekochten autobiographischen Standardsituationen, billigen Witzchen, faden Anekdötchen und jeder Menge Bilder, für die man gar nicht irgendwo hinfliegen muss, weil sie aus den Nachrichten schon sattsam bekannt sind.
Guy sitzt am Schreibtisch. Guy fährt eine leere Straße entlang. Guy sucht einen Spielplatz für die Kinder. Guy steht im Berufsverkehr. Guy geht ins Treppenhaus. Guy sucht einen Spielplatz für die Kinder. Religiöse Fanatiker sind fanatisch. Guy sitzt am Schreibtisch. Guy sitzt auf einem Betonklotz und zeichnet eine Mauer. Guy hält einen Vortrag. Guy steht im Berufsverkehr. Guy geht ins Treppenhaus. Religiöse Fanatiker sind fanatisch. Guy sieht eine Schildkröte. Guy sitzt auf einem Betonklotz und zeichnet eine Mauer. Die Schildkröte ist weg, hihihi. Guy fährt eine leere Straße entlang. Komische Religion ist komisch. Schlimme Sachen da, im Nahen Osten. Guy sucht einen Spielplatz für die Kinder. Guy sitzt am Schreibtisch. Guy schaut einen Horrorfilm und fürchtet sich im Dunkeln, hihihi. Guy geht ins Treppenhaus. Religiöse Fanatiker sind fanatisch. Guy steht im Berufsverkehr. Schon schlimm da, im Nahen Osten, nicht wahr? Guy zeigt einer Bekannten eine Zeichnung einer Mauer. Guy sitzt auf einer Mauer und zeichnet einen Betonklotz.
Sagenhaft, dieses Jerusalem.
Die guten, pointiert erzählten Beobachtungen, auf die man in diesem 300-seitigen Heuhaufen von einem schlechten Buch stößt, scheinen am Ende eher der statistischen Unvermeidbarkeit geschuldet als einem irgendwie gearteten Auswahlprozess Delisles.
Ist Chroniques de Jérusalem ein politisch oder journalistisch motiviertes Buch? Eine Haltung sucht man vergebens, und Delisle sagt dem Leser nichts von Belang, was jemand, der ein solches Buch liest, nicht schon längst wissen wird. Ist es persönlich motiviert? Obwohl er andauernd durchs Bild latscht, gibt Delisle nichts von sich Preis, was der Rede wert wäre. Zu einer faszinierenden Figur fehlt ihm ungefähr alles, was seine permanente Gegenwart nicht erträglicher macht. Offenbar muss man ihn einfach lieben. Seine Frau und Kinder bleiben ohnehin konturlose Statisten. Ist die Motivation vielleicht eine literarische? Dazu fehlt es Delisle an dem geschärften Blick und der Neugier, die beispielsweise auch Sacco auszeichnen. Delisle selektiert nicht, verdichtet nicht, verändert nicht die Perspektive, sucht nicht die Auseinandersetzung. Delisle reiht nur wahllos aneinander. Und zeigt Delisle.
Dass du die Stelle mit dem „MacGyvern“ als besonders lustig erwähnst, ist bezeichnend, denn im französischen Original findet man nichts dergleichen. Da steht nur lapidar „bricoler“, was einfach „basteln“ oder „fummeln“ bedeutet. MacGyvern tut hier nicht Guy Delisle, mein lieber Wederhake, sondern Helge Dascher, die den traurigen Schinken ins Englische übersetzt hat.
Alle paar Seiten bekundet Delisle implizit oder explizit, etwas nicht zu verstehen – und belässt es dann demonstrativ dabei. Angebote und Gelegenheiten, etwas über seine Umgebung zu erfahren, sucht er nicht, schlägt sie gar aus, wenn sie ihn trotzdem finden. Gesprächen mit Einheimischen geht er meist aus dem Weg, er lässt sie versanden oder blendet sie in seiner Darstellung kurzerhand aus. Hätte ihn seine Putzfrau (die ihm komisch vorkommt, mit der er aber auch lieber nicht redet) nicht beizeiten von seinem Schreibtisch vertrieben, wären es wohl 330 Seiten über Guy Delisle an seinem Schreibtisch in einem Hochhaus in Jerusalem geworden. Delisle stilisiert sich zum stolzen Ignoranten, zu einem bekennenden Einfaltspinsel, der seine arrogante Uninteressiertheit an allem, was um ihn herum geschieht, wie ein Pfau zur Schau trägt und sie als Charme verkaufen will.
Es scheint so, als wolle Delisle seinen Lesern Ansprüche wie Haltung oder Neugier lieber nicht zumuten. So muss etwa die Tatsache, dass Zuhörer eines seiner Kurse Tintin nicht kennen oder aus religiösen Gründen keine nackten Figuren sehen wollen, im sehr grauen und sehr schlichten Kosmos des Guy Delisle als Pointe herhalten. Zynismus aus Angst vor der eigenen Courage?
Mit am schlimmsten an der durch und durch lustlosen Präsentation dieses bauchnabelfixierten Einerleis ist die hässliche graue Tunke, in die Delisle seine abgestandenen Oberflächlichkeiten taucht. In Pyongyang konnte man ihm diesen Schleier des Todes noch als Stilmittel auslegen, hier kündet er vom morbiden Desinteresse eines Autors an seiner Arbeit, an der Welt und an sich selbst.
Es herrscht ein beklemmender Mangel an Kreativität in Chroniques de Jérusalem, an künstlerischer, menschlicher und politischer Glaubwürdigkeit, an Vertrauen in den Leser, an erzählerischem Mumm. Und es fehlt hinten und vorn an Wahrhaftigkeit und Einsicht, weil das Naheliegendste immer gut genug ist für Guy Delisle. Am allermeisten aber fehlt es an einem Thema, was vielleicht das größte Kunststück ist, das Delisle bislang vollbracht hat: dreihundert Seiten über Israel – und kein Thema in Sicht.
In Saccos Journalism finden sich klug beobachtete, literarisch verdichtete und pointierte Episoden, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben, sich auf den zweiten Blick aber zu einer Weltkarte menschlicher Belange fügen, die eine klare Haltung zum Menschsein und zur eigenen Rolle erkennen lässt und zur Diskussion stellt. Bei Delisle ist es genau umgekehrt. Er serviert einen Stapel unsortierter, unmotivierter und meist banaler Beobachtungen, die durch ihre Kulisse einen Zusammenhang simulieren, letztlich aber nicht den Hauch einer Idee transportieren.
Fast jeder Szene ist anzumerken, dass Delisle nicht aus eigenem Antrieb in Jerusalem ist, als sei es ihm ein besonderes Anliegen, da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Land und Leute interessieren ihn nicht die Bohne, aber er bringt dennoch genügend Disziplin mit, jeden Tag brav seine Seite runterzuzeichnen, komme, was da wolle – und so versteht man denn auch, wieso es am Ende fast 365 geworden sind. Unter den Cartoonisten macht ihn das zu so etwas wie dem Beamten vom alten Schlag, der seine Arbeit streng nach Vorschrift verrichtet, ohne Liebe und mit einem Minimum an Aufwand – und keine Sekunde länger, als er muss.
Du bist einem Scharlatan aufgesessen, Wederhake, und du bist leider in guter Gesellschaft. Delisle ist ein Windbeutel und dieser Comic eine Strafe für jeden Leser. Chroniques de Jérusalem wirkt, als habe sich sein Autor nur deshalb durch die 300 Seiten gequält, um nicht über ihren Inhalt nachdenken zu müssen. Es ist ein Buch, das die Menschen nicht nur dümmer macht, sondern ihnen dabei auch noch das Gefühl gibt, etwas gelernt zu haben.
![]()
Chroniques de Jérusalem
von Guy Delisle
Delcourt, 2011
Softcover, farbig, französisch, 330 Seiten, etwa 24,00 Euro
ISBN: 978-2-7560-2569-8
Anmerkung: Die deutsche Fassung, Aufzeichnungen aus Jerusalem, ist bei Reprodukt erschienen und wurde bei Comicgate hier besprochen.
Abbildungen: © Joe Sacco/Metropolitan und Guy Delisle/Drawn & Quarterly/Delcourt

Pingback: Frisch aus der Druckerei: März 2017 |