Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: Berserk von Kentaro Miura und Prison Pit von Johnny Ryan.
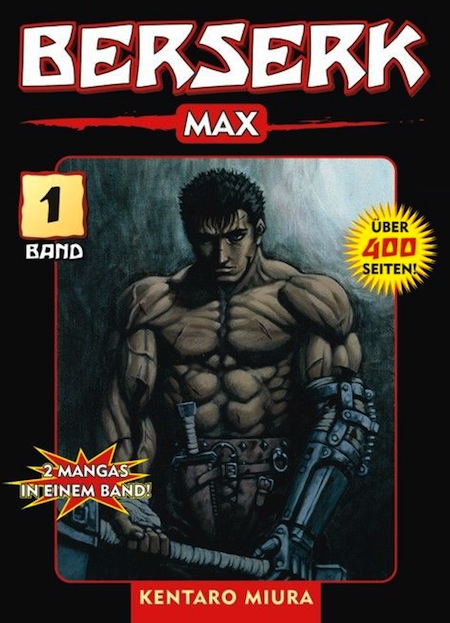
WEDERHAKE: Was braucht es eigentlich, um ‘ne neue „2gegen1“-Folge zu produzieren? Und warum haben USA und Konsorten dieses riesige Spähprogramm aufgebaut? Um für mich herauszufinden, wo du lebst, Frisch. Saarbrücken also. Eine Geisterstadt in der menschenverlassenen, mutantenverseuchten, semi-barbarischen Einöde des Saarlandes, im Shadowrun-Universum immerhin zur fast schon zivilisierten Sonderrechtszone nach dem Cattenom-GAU deklariert. Und wo ich schon hier bin und ‘nen Rucksack mit Comics und ‘ne Keule mit Nagel durch dabei habe, kannst du auch mal wieder was rezensieren, du arbeitsscheues Gesindel. ‘Nen Manga nämlich. Also: Rezensier oder der Köter bekommt’s!
Berserk, Frisch. Kennste, nee? Wurde mir nämlich empfohlen von unserer lokalen Manga-Expertin, nachdem ich Vinland Saga in den höchsten Tönen gelobt habe, weißte? Junger Kerl mit doofem Namen („Guts“, ne?) zieht mit ‘nem Schwert von der Größe eines Kleinbusses durch ein pseudo-mittelalterliches Fantasyland und metzelt alles mögliche niedere Getier entzwei, das nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die er aber auch entzwei metzeln würde, mit seinem Schwert, das kaum größer ist als Carsten Jancker, ne? Für Japan-Verhältnisse also so ‘ne Art Taschenmesser, das der Guts da hat. Begleitet wird er unfreiwilligerweise von Puck, ‘ner Feen-Elfe (oder ‘nem Elferich, ne?) die als sowas wie’s Gewissen von Guts fungiert. Andere Figuren gibt es zwar in Band 1 auch noch, die haben aber, wie schon gesacht, nur die Funktion, von Guts entzwei gemetzelt zu werden oder von Dingen entzwei gemetzelt zu werden, die dann wiederum von Guts entzwei gemetzelt werden, mit Hilfe seines Schwertes, das viel größer ist als so’n durchschnittlicher Comic im Cross-Cult-Format. Ne?
Damit ich mitter bescheuerten Schreibe aufhören kann, die dich sicher inzwischen nervt, ne: Ich lese ja selten übersetzte Comics, so dass mir die handwerklichen Fehler der Übersetzer entgehen… aber auch ohne Vorerfahrung, Frisch: Die deutsche Version von Berserk gehört zum schäbbichsten, was ich bisher zu lesen gezwungen war. Nun weiß ich nicht, wie kohärent und idiosynkratisch die Dialoge im Original sind, aber in der deutschen Version zieht sich durch die kompletten ersten beiden Bände eine Reihe von wenig erbaulichen Sprachmacken. Das geht damit los, dass fast alle Figuren reden, als seiense ‘nem Brösel-Comic entsprungen (willse dir gar nich’ vorstellen) und dass die Elfe zumindest im Deutschen die völlig unsinnige Sprachmarotte hat, dauernd ein sinnloses ‘ne’ oder gerne auch ‘nee’ vor, hinter oder mitten in ihre Sätze zu transportieren. Ich will also nicht ausschließen, dass „Holger Hermann Haupt“, der Übersetzer, nur ein Pseudonym von Mario Barth ist. Ich glaube, das ist sogar ein Anagramm, ich bin aber zu lethargisch, das jetzt zu überprüfen. Mario Barth und Manga, ne, Frisch, ne? Kennste, ne? Ne? Ganz zu schweigen davon, dass sich viele Dialoge so zerrupft, halbfertig oder schlicht keinerlei logischen Sinn ergebend lesen, dass sich ‘ne durchschnittliche Condor-Interpart-Übersetzung aus den 1980ern dagegen ausnimmt wie ein Thomas-Mann-Roman.
Zumindest in der englischen Version scheinen diese Marotten nicht zu finden zu sein und in Band 3 gibt’s ‘nen anderen Übersetzer, da ist also auf Besserung zu hoffen.
So, mit dem aus dem Weg: Der erste Band, auf den ich mich hier hauptsächlich stütze, ist ein solide unterhaltsamer, leicht überdrehter Barbaren-Blödsinn (oder Low Fantasy, für Menschen mit ‘ner sehr präzisen Karte der Genre-Grenzen), der mir mehr Spaß macht als gefühlte drei Viertel der sonstigen Barbarencomics, wie zum Beispiel die weitgehend belanglos-öden Conan-Dinger, mit denen Dark Horse seine Messestände tapeziert, und die selbst Joe R. Lansdale zur harmlosen Beliebigkeit degradieren.
Band 1 beginnt im wahrsten Sinne des Wortes in medias res mit ‘ner Sexszene samt monströser Verwandlung, die mich glauben lässt, dass Kentaro Miura seinen Conan-Film gesehen hat. Im Folgenden wird dann ein relativ konsequentes Programm abgespielt: Guts latscht irgendwo hin, gibt sich menschenverachtend, trifft ein Monster, gibt sich monsterverachtend, bekommt ganz böse die Hucke voll und haut davor, dazwischen und danach einen ganzen Schwung an Menschen und Monstern entzwei. Das ist weder sonderlich kreativ, noch sonderlich feingeistig, aber immerhin so überzeichnet und überzogen, dass es – mit ‘ner Metal-Platte als Hintergrundbegleitung – unterhaltsam ist. Aufgewertet wird der Manga dann, wenn man ihn nicht in der U-Bahn oder sonst in der Öffentlichkeit liest und man die Schnetzelszenen und die freigiebig ausgeteilten Entzwei-Metzelungen mit dem Schwert von der Höhe einer Altbaudecke mit eigenen Soundeffekten wie „SWOOOSH“, „SPLURRRGLE“, „GAAAARRRRGGGHHH“ und ähnlichem untermalen kann. Das ist nämlich total der Manga für sowas. Und wenn du dann auch noch Clint Eastwoods deutsche Synchronstimme imitieren kannst, um Guts Dialoge zu vertonen, dann bist du auf der Siegerstraße.
Barbarencomics in Japan vor 25 Jahren bedeuten auch, dass man sich keine Illusionen machen sollte, dass man hier politisch korrekte oder sonderlich anspruchsvolle Unterhaltung bekommt. Wenn du aber in Urinpfützen landende Elfen lustig findest (ich verstehe, wie man Mario Barth für die Übersetzung gewinnen konnte), dann wirst du dich hier zu Hause fühlen. Sauer aufgestoßen ist mir aber der Umstand, dass man eine einzige schwarze Figur bis zum Beginn von Band 2 einführt, die visuell mit typischen „primitiver Wilder“-Markern ausstattet und die sich gleich mal innerhalb von vier Seiten als pädophiler Vergewaltiger entpuppt. Dieser Subtext ist zwar genauso Robert E. Howard wie das Schlangenmonster, aber … ey, Japan. Selbst 1989 ging das besser.
Visuell ist das in diesem Band erst einmal handwerklich solide. Ich würde jetzt nicht, wie ein anderer Rezensent, den Vergleich mit guten frankobelgischen Zeichnern auspacken, aber ich habe davor, wie gesagt, Vinland Saga gelesen und die detaillierten Figuren da und die epischen Landschaftsportraits haben mich natürlich auch verwöhnt. Im Vergleich wirken die Wälder und Städte im ersten Berserk öd und leblos (du wirst dich also wie zu Hause fühlen, Frisch), die Gesichter der Figuren doch noch arg hölzern, und einige Posen nehmen die Anatomie der Superheldencomics der 1990er vorweg, aber – hey! – wenn’s darum geht, eklige Monster zu schaffen (sowohl jene, die sich an Fantasyklischees bedienen als auch andere), dann glänzt Miura. Gleiches gilt dafür, wenn die Figuren dann im Folgenden ganz zünftig in kleine, doggy-bag-passgerechte Portiönchen entzwei gemetzelt werden. Da hat der Mann ‘ne ordentliche Dynamik in seinem Strich und erfreut mein Herz damit, wie oft Personen und Monster physikalisch fragwürdig gleichzeitig in verschiedene Richtungen (Schwert von der Größe von Ron Jeremys Phallus, du erinnerst dich?) davonsegeln. Und wenn ich das mit dem Lateinstundencomicniveau-Schindluder vergleiche, das Hajime Isayama derzeit im vielgelobten Attack on Titan hinrotzt, dann ist das Niveau in den letzten 25 Jahren eh so weit nivelliert worden, dass meine Kritik vielleicht zu fundamental ist.
Was bleibt also, Frisch? Ein stellenweise problematischer, solide gezeichneter, in der deutschen Übersetzung aber echt unerträglich verfasster Genre-Schund, der mir immer dann besonders viel Spaß macht, wenn ich wie so’n Siebenjähriger mit ‘nem Ast in der Hand Schwertkampfgeräusche von mir geben kann. Für ein „Meisterwerk“ (Rückseitentext) vielleicht ein bisschen dünn, aber reizt mich eher zum Weiterlesen als die Mehrzahl der Kulls und Conans, die Dark Horse in Serienproduktion ausspuckt.
Und jetzt lasse ich dich aus der Besenkammer raus, um mal zu hören, was du als Einwohner eines Fantasylandes dazu sagst, Saarländer!
![]()
Berserk Max, Bände 1-2*
von Kentaro Miura
aus dem Japanischen von Holger Hermann Haupt
Panini/Planet Manga, 2006
Softcover, schwarzweiß, 400-476 Seiten, je 10 Euro
ISBN: 3-86607-171-X (Band 1)
*Anmerkung der Redaktion: Berserk Max ist eine Neuauflage von Berserk, bei der jede Ausgabe zwei ursprüngliche Bände beinhaltet.
* * *
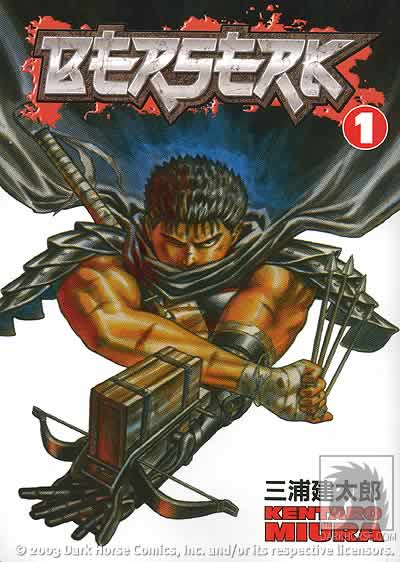
FRISCH: Wer in Kassel sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, Wederhake. Obwohl du nicht so falsch liegst, wie du vielleicht denkst, was die saarländische Einöd angeht.
Bevor wir ans Eingemachte gehen, aber noch ein Wort zu deinen Maßstäben. Wenn du bei Berserk mit fragwürdiger Physik, „problematischen“ Elementen, hölzernen Figuren oder öden Wäldern ankommst, könnte man nämlich den Eindruck gewinnen, Herr Miura sei irgendwie an einer halbwegs ernstzunehmenden Spiegelung irdischer Verhältnisse interessiert, und das hielte ich für eine dreiste Unterstellung. Meine These: Berserk ist so bekloppt, dass von den durchaus zahlreichen darin vorkommenden Verstößen gegen Moral (Sexismus, Rassismus, Misanthropie), Geschmack (Blut, andere Säfte, Rumpel-Storytelling) und Realität (Physik, Psychologie, Logik) kaum irgendeiner groß heraussticht.
Berserk ist nicht „problematisch“, Wederhake, Berserk ist ein Problem. Und wenn du mit einem Lösungsanspruch („Was zur Hölle stimmt nicht mit diesem Comic?“) an die Sache herangehst, dann wirst du daran zerschellen wie ein Shitstorm an Jasper von Altenbockum. Schmeißt du dem Berserk-BSE-Problembullen aber einen Sattel über und versuchst ihn zu reiten, dann kriegst du am Ende, was du verdienst: blaue Flecken am Arsch deines ästhetischen Empfindens und eine ziemlich genaue Vorstellung davon, ob du noch mal willst.
Da ist es fast ein bisschen schade, dass die englische Übersetzung von Jason DeAngelis, in welcher ich den ersten Band (also die ersten drei Kapitel) gelesen habe, relativ unauffällig und funktional daherkommt. Ein bisschen kongenialer Rinderwahnsinn hätte nichts geschadet. Andererseits weiß ich mangels Japanisch-Kenntnissen auch nicht, womit der Kollege arbeiten musste, also keine Kritik von mir, was das angeht; DeAngelis macht das ordentlich.
An dieser Stelle sind nun mehrere Disclaimer angebracht. Erstens: Ich habe bloß den ersten Tankōbon gelesen, und inzwischen – nach 25 Jahren – gibt es davon immerhin 37, die knapp 350 Einzelepisoden sammeln. Anders gesagt: Von insgesamt (hochgerechnet) 7.400 Seiten Berserk kenne ich gerade einmal 200. Das sind viele Comic-Seiten und viel Zeit, um sich – rein theoretisch – weiterzuentwickeln. Zweitens: Kentaro Miura, Jahrgang 1966, hat außer Berserk kaum etwas anderes gemacht, seit 1988 sein Ur-Guts erschienen ist. Da gab’s noch den einen oder anderen Einzelband und einen Berserk-Anime, aber unterm Strich kann man Berserk, den Manga, zu diesem Zeitpunkt getrost als Miuras Lebenswerk bezeichnen, und darüber lässt sich anhand eines Bandes schlecht urteilen.
Drittens: Nachdem ab 1990 vier Bände der Reihe (angefangen mit dem vorliegenden) bei Hakusensha erschienen waren, ist Berserk seit 1992 Bestandteil von Young Animal, dem Seinen-Magazin des Verlags – wo nicht nur die enthaltenen Manga-Reihen auf die Bedürfnisse junger (und, ähm, jung gebliebener) Männer zugeschnitten sind, sondern auch ein Mantelteil mit Fotos spärlich bekleideter, lasziv dreinblickender Mädchen. Sexismus und adoleszente Gewaltfantasien sind hier also kein Versehen, sondern Programm. Man kennt sein Publikum – und bedient es.
Dieser Kontext verrät nun schon einiges über Berserk. Was er nicht erklärt, ist die offenkundige Faszination der Serie. Fangen wir beim Helden an: Er heißt „Guts“, trägt eine „eiserne Hand“ als Prothese und erlöst in seiner ersten Geschichte ein mittelalterliches Dorf von einem bösen Tyrannen. Der Gedanke, Götz von Berlichingen könnte für Miura ein ähnlicher Quell der Inspiration gewesen sein wie die nordische Sagenwelt es für Lee und Kirby war, liegt da nicht allzu fern. Miura schwört Stein und Bein, es handele sich um einen Zufall; er sei ganz und gar erstaunt gewesen, sagt er, als er vom historischen Götz erfuhr. Ich behaupte: Er lügt wie gedruckt.
Ob Guts von Berlichingen wirklich der niederträchtige Misanthrop ist, für den er sich nach Kräften ausgibt, das stellt Miura bisweilen infrage, aber immer nur ganz kurz. Das Handeln der Figur lässt eigentlich keinen Zweifel, dass wir es mit einem besonders gemeinen Psychopathen zu tun haben, der anderen Wesen bestenfalls Missachtung entgegenbringt, aber Miura kokettiert immer wieder mit der Möglichkeit, dass sich hinter der schwarzen Seele seines Helden vielleicht doch ein Herz aus Gold verbergen könnte – nur, um sie direkt wieder genüsslich zu verwerfen.
Dass Berserk ein misogyner Gewaltporno für Männer ist, zeigt sich indes bereits auf den ersten fünf Seiten. Im allerersten Panel besteigt Guts eine gesichtslose Frau, die im vierten Panel zum Monster wird, welches er bis zum Ende von Seite fünf mit großer Begeisterung und unter lauten Schmerzensschreien erschlagen hat.
Auch in den weiteren Kapiteln spielen Frauen eine Rolle. Im zweiten ist es eine junge Pfarrerstochter, frei von jeglichen schlechten Eigenschaften, die unvermittelt von Dämonen umgebracht wird und daraufhin als Dämonin zurückkehrt, damit sie von Guts zweigeteilt werden kann. Im dritten schließlich wird die einzige Frauenfigur mit Sprechrolle schon auf Seite Drei von der Inquisition enthauptet; der Kopf wird danach noch ein paarmal als Requisite rausgekramt und schließlich zermatscht. Die erste der drei weiblichen Figuren des 200-Seiten-Bandes wird als „Schlampe“ bezeichnet; die zweite als „meine Tochter“ und „dumme Gans“; die dritte als „Beschuldigte“ und „Ketzerin“. Einen Namen erhält keine von ihnen. Sagen wir mal so: Den Bechdel-Test besteht Berserk eher nicht.
Was nicht heißt, dass Miura der Geschmack am Spiel mit Gender-Rollen völlig abgeht. Er legt Wert darauf, Gutsens nackten androgynen Elfen-Sidekick Puck – eine Art Putto, bloß mit Insektenflügeln und ohne Schniedelwutz – immer wieder aufreizend in Pose zu stellen. Mal streckt Puck ihren strammen weißen Knabenpopo ins Bild, mal kommen die Female-Bondage-Fans unter den Lesern auf ihre Kosten. Guts selbst reagiert auf Puck einerseits mit Spott und allerlei Gemeinheiten, andererseits mit homophob anmutender Scheu, wenn man sich zu nah kommt – üblicherweise ein Signal, dass zwischen den Figuren sexuelle Spannung knistert. In dem Fall ließe sich also ein leichter Boys’-Love-Einschlag feststellen, denn mit Zuwendungen des weiblichen Geschlechts hat Guts ja keine Probleme.
Ein weiteres wiederkehrendes Motiv in Berserk sind Körperflüssigkeiten. Die Szene, in der Puck in einer Urinpfütze landet, erwähntest du bereits; das Blut fließt ohnehin in Strömen. Zudem die von Guts gelieferte Definition eines Incubus: „Incubi are born of the mixed blood and sexual fluids of those who died“. Plitsch, platsch. Miura hat Spaß daran, mit menschlichen Säften um sich zu spritzen.
Und erwähnenswert ist eben auch, dass Guts nicht der allseits bekannte Typ grimmiger, grübelnder Rächer ist, sondern ein überaus gut gelaunter, dessen unbelastete Freude am Schlachten Miura mit viel Gusto inszeniert. Wodurch Berserk sich von vielen Vertretern gewaltbasierter Jungs-Genres (siehe auch: Superhelden) angenehm abhebt, deren Protagonisten sich bei der Ausübung ihrer Kernkompetenz demonstrativ quälen müssen, um ihrer Leserschaft etwaige Schuld- und Schamgefühle auszutreiben, die derartige Neigungen mit sich bringen mögen.
Diese konsequente und unapologetische Bekenntnis zum Fetisch macht Berserk sympathisch, und der angeführte schräge Mix aus Götz-Kult, Gender-Verwirrung und Körpersäfte-Gesudel geben dem Ganzen die nötige Würze. Das alles ergibt noch keinen guten Comic – aber einen, der unberechenbarer und damit unterhaltsamer ausfällt als viele, die weniger übergriffig und besser umgesetzt sind.
![]()
Berserk, Vol. 1
von Kentaro Miura
aus dem Japanischen von Jason DeAngelis
Dark Horse Comics/Dark Horse Manga, 1990
Softcover, schwarzweiß, englisch, 196 Seiten, 13,95 US-Dollar
ISBN: 978-1-59307-020-5
* * *
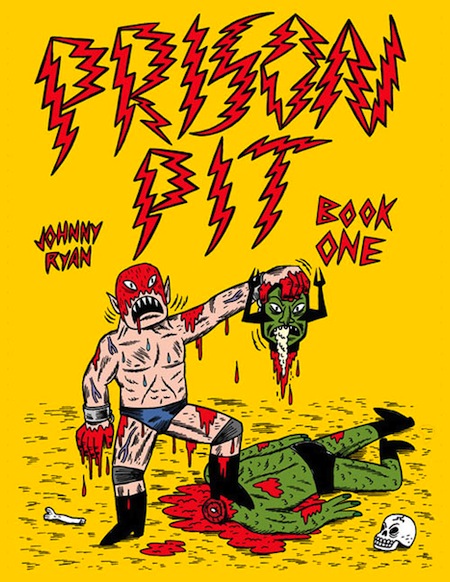
FRISCH: Wenn man Johnny Ryan nach den Einflüssen von Prison Pit fragt, nennt er zuerst Berserk, was auch der Grund für meine Neugier auf Miura war. Man kann, wie du schon angemerkt hast, Wederhake, Miura nun kaum unterstellen, er wolle seine Gemetzel mit Plots, Figuren oder Dialogszenen verwässern. Trotzdem stellt Prison Pit im Vergleich zu Berserk noch einmal eine gehörige Reduktion dar; wenn Berserk gefühlt zu 70 Prozent aus Kampfszenen besteht, dann sind es bei Prison Pit mindestens 95.
Wobei die zwei Serien rein visuell wenig gemein haben. Miura variiert ständig den Seitenaufbau, arbeitet viel mit Schattierungen und gestaltet seine Zeichnungen oft – wie im Fantasy-Genre nicht unüblich – sehr detailreich. Der gut vier Jahre jüngere Ryan hingegen kommt aus der Alternative- und Funny-Ecke, steht stilistisch einem Peter Bagge also sehr viel näher als den einschlägigen Vertretern irgendeines Abenteuer-Genres.
Auch inhaltlich gibt es zunächst kaum Gemeinsamkeiten. Berserk spielt in einer typischen Sword-&-Sorcery-Welt, bei Prison Pit haben wir’s mit einem futuristischen Endzeit-Szenario zu tun: Der als „Cannibal Fuckface“ bekannte, im Comic aber namenlose Protagonist wird auf einem öden Gefängnisplaneten abgeworfen und muss fortan um sein Leben kämpfen. Ende des Plots. Mit anderen Worten: Prison Pit ist ein Prügelcomic. Wer Spaß daran hat, wenn monströse, bizarre und meistens auch noch ziemlich gemeine Kreaturen einander unentwegt vermöbeln, verstümmeln und aufs Grausigste massakrieren, der kommt hier auf seine Kosten. Es wird geboxt, getreten, gebissen, gekratzt und geritzt, mit Gedärmen geworfen, mit Ohrenpopel geschnippt, gespalten, aufgeschlitzt und gefressen, gepisst, gespuckt und gewichst, es wird gekackt und gekotzt und es werden Pickel ausgedrückt, um den Rivalen damit zu malträtieren. Der Endgegner des ersten Bands schrubbt sich mal eben sein eigenes Instant-Kampf-Exoskelett aus Ejakulat. Es gibt kaum eine Geschmacklosigkeit, die von Ryan ausgelassen wird, und wenn doch, dann wohl aus Versehen.
Die oberflächlichen Unterschiede zu Berserk täuschen allerdings. Durch die angesprochene Reduktion auf möglichst blutige Kämpfe, die Miura pflegt und die Ryan endgültig auf die Spitze treibt, treten Elemente wie Handlung oder Kulisse in den Hintergrund und die stilistischen Unterschiede werden als Variationen desselben Themas erkennbar.
Ryan passt seinen Stil diesem Thema durchaus an, denn anders als bei seinen Gag-Strips, die seit 1994 unter anderem als Angry Youth Comix oder bei Vice erscheinen, findet man in Prison Pit keine mit neun bis 16 Kästchen und mindestens genauso vielen Sprechblasen vollgestopften Seiten, sondern ein vergleichsweise luftiges Vier-Panel-Gitter. Zudem gibt sich der Comic äußerst wortkarg und räumt seinen Bildern allen Platz fürs Erzählen ein. Die fünf Bände bringen es jeweils auf über 110 Seiten, dennoch gibt es pro Band nur etwa drei Kampfsequenzen zu sehen. Das sind im Schnitt also mehr als 30 Seiten pro Prügelei, und die nutzt Ryan dazu, die Kämpfe lustvoll durchzuchoreografieren – inklusive Ruhepausen dazwischen, in denen Fuckface seine Wunden leckt, oder lecken lässt.
Etwas fad wird es dabei ansatzweise immer dann, wenn Ryan es mit der Handlung übertreibt – wenn etwa in Band 3 ein sogenannter „Erzgegner“ auftaucht, der an Fuckface Rache nehmen will; oder wenn sich in Band 5 die Gefängnisleitung entschließt, einzugreifen. In jenen Momenten kommt es einem vor, als hätte Ryan kurzzeitig vergessen, was den Appeal von Prison Pit ausmacht: die völlige Abwesenheit derartigen Schnickschnacks.
Glücklicherweise fällt es ihm aber recht zügig wieder ein. Dann fluchen die Figuren in Prison Pit wieder wie die Rohrspatzen und hauen sich Kraftausdrücke und Obszönitäten um die Ohren (sofern noch vorhanden), welche vom geistigen Niveau her dem Mundwerk eines besonders böswilligen und verhaltensgestörten Sechsjährigen entstammen könnten, wenn sie nicht so bestechend pointiert wären. Und sie durchlaufen dabei mit zunehmender Verstümmelung immer bizarrere Metamorphosen, die etwas Hypnotisches an sich haben und auch der Fantasie Jim Woodrings entsprungen sein könnten, wenn Jim Woodring der Teufel wäre und schwer drogenabhängig. Eine beeindruckend inszenierte Abscheulichkeit toppt die nächste, der Ästhetik des Guten und Schönen wird systematisch der Krieg erklärt, das Hässliche und Gemeine zur Kunstform erhoben.
Unterm Strich verhält sich dabei Ryan zu Miura etwa so wie Crumb zu Manara: Beide sind für ihre sexualisierten Frauendarstellungen bekannt, aber während der „male gaze“ bei Manara – auf nicht selten unfreiwillig komische Weise – bedient wird, wird er bei Crumb karikiert. Mit Prison Pit und Berserk ist es ganz ähnlich, bloß eben mit Gewaltexzessen statt Sex. Denn anders als Miura signalisiert Ryan dem Leser deutlich, dass die Kämpfe inszeniert sind—zum einen durch Merkmale, die etwa vom Wrestling oder aus Prügel-Videospielen wie Tekken bekannt sind (Outfit, Trashtalk, theatralisches Auftreten der Heels), zum anderen eben durch die irrwitzige Überzeichnung der Kampfszenen.
Wobei die Frage, ob Ryan Satire betreibt oder sich bloß in seinen Neigungen suhlt, nicht unumstritten ist. Der US-Kritiker Jacob Canfield etwa legt überzeugend dar, dass Ryan zumindest in seinen Strips wohl eher stumpfe Provokation betreibt. Bisweilen muss er sich auch blanken Rassismus vorwerfen lassen, weil ein konkreter Bezugspunkt als Objekt der vermeintlichen Satire schlicht nicht auszumachen ist. Die vage Absicht, den Leser irgendwie zu schockieren, macht eben noch lange keine Satire. (Siehe auch: Mark Millar.)
Prison Pit würde ich aber durchaus als satirisch bezeichnen. Denn die Gewalt, die hier zelebriert wird, karikiert jene Gewaltdarstellungen, die nicht nur in der US-amerikanischen Medien- und nicht zuletzt Comic-Landschaft alltäglich sind. Ryans Satire wird als solche erkennbar, indem sie ihrem Gegenstand aus zwei Richtungen kommend das Wasser abgräbt: Zum einen gehen die Gewaltdarstellungen hier weit über das hinaus, was etwa in einem Hollywood-Actionfilm oder einem DC-Superheldencomic zu sehen ist; zum anderen steht Ryans Cartoon-Stil im krassen Gegensatz zu dem, was der Mainstream als „erwachsen“ und „realistisch“ verkaufen will. Das hier ist nicht die glattgewichste Fascho-Ästhetik eines Zack Snyder oder Christopher Nolan, das hier ist der irre Anarcho-Klamauk von Tom & Jerry oder „Itchy & Scratchy“. Ryan verhöhnt alltägliche Darstellungen von Gewalt, wie sie etwa im Superheldengenre gezeigt werden, geradezu: Er zeigt ihnen, wie hasenfüßig sie trotz ihrer Attitüde mit dem Thema umgehen, während er sich gleichzeitig über ihren heuchlerischen Stil mokiert. Er liefert den konsequenteren Gewaltporno und entlarvt zudem den vom Mainstream simulierten „Realismus“ als albern und pubertär.
Auch die bei Miura bereits extrem marginalisierte Rolle weiblicher Figuren reduziert Ryan weiter: Es gibt keine Frauen in Prison Pit. Was aber nicht bedeutet, dass Weiblichkeit keinen Platz hätte. Die kommt schon vor: mal in Gestalt von penisköpfigen Zwitterwürmern mit vaginaförmigen Mäulern, die sich über eine Blutlache hermachen; mal als vaginaförmige Kontrollbuchse eines Raumschiffs, das mittels Penis des Piloten gesteuert wird; und vor allem als „Ladydactyl“, ein monströser Raubvogel, der zunächst durch zwei Brüste als weiblich erkennbar wird. Das wäre nun alles freilich schon „problematisch“ genug, doch letzteres ist erst der Auftakt zu einer Episode, in der es um eine Mission mit dem Titel „Operation: Rape Ladydactyl“ geht, in welcher die Hauptfigur zur Marionette eines verrückten Wissenschaftlers wird, der es auf Ladydactyl abgesehen hat. Und weil Johnny Ryan Johnny Ryan ist, ist der Name der Mission dabei Programm.
Weiblichkeit wird in Prison Pit also grundsätzlich als etwas präsentiert, das von den männlichen Figuren penetriert werden muss. Dass dadurch unverhohlene Misogynie transportiert wird, dürfte niemand ernsthaft bestreiten; dass Ryan das tut, um zu provozieren, ist ebenso klar. Zwei Fragen ergeben sich daraus. Erstens: Ist das noch Satire? Zweitens: Wie gehen wir damit um?
Die erste Frage ist einfacher zu beantworten als die zweite. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist leider nichts Ungewöhnliches — nicht in der Realität, nicht in der Populärkultur, nicht im Comic, schon gar nicht im US-amerikanischen Comic.
In Comics wie Identity Crisis oder The League of Extraordinary Gentlemen müssen Vergewaltigungen weiblicher Figuren als Plot-Hebel herhalten und als Stilmittel, um eine besondere Ernsthaftigkeit der jeweiligen Geschichte zu suggerieren — und, als wäre das nicht schon billig genug, werden die Darstellungen gern auch noch erotisiert, damit man dem Publikum den Kitzel und das Grauen gleich im Doppelpack verkaufen kann. Insofern ist es konsequent, dass Ryan auch hier nicht davor zurückschreckt, dem Mainstream den Spiegel vorzuhalten. Er erotisiert und melodramatisiert nicht, sondern karikiert und überspitzt ins Groteske – zwar ohne Rücksicht auf Verluste und mit der klaren Absicht zu schocken, aber keineswegs ohne konkreten Anlass.
Und Satire, daran sollte man an dieser Stelle erinnern, muss nicht lustig sein. Die Ladydactyl-Episode in Prison Pit ist alles andere als lustig. Sie ist völlig hirnrissig und verursacht nicht nur deshalb Unbehagen, insbesondere, weil über mehr als 50 Seiten auch das kleinste Detail jener „Mission“ dargestellt wird. Das kann man geschmacklos finden. Ich finde Ryans Ansatz allerdings weniger geschmacklos als etwa den eines Alan Moore, dessen The League of Extraordinary Gentlemen: Century – nicht zum ersten Mal in Moores Werk – eine betont „realistische“ Vergewaltigung andeutet, und das nicht etwa, um weiter zu erforschen, was das für die betreffende Figur bedeutet, sondern um seinen Abenteuerplot in die gewünschte Richtung zu lenken. Prison Pit entlarvt diesen oberflächlichen Umgang mit sexueller Gewalt, indem es die perfide und manipulative Mechanik dahinter mit letzter Konsequenz auf dem Seziertisch offenlegt, ohne dem Leser dabei die hässlichsten Bilder zu ersparen, wie etwa Moore das bequemerweise tut. Satire ist also gegeben.
Das macht den Versuch einer Antwort auf Frage zwei freilich nicht leichter, denn ob der Gegenstand der Satire ihre Mittel rechtfertigt, das bleibt letztlich dem Urteil des einzelnen Lesers überlassen. Auch könnten wir uns hier über die Notwendigkeit von Verboten, Indizierung, Altersfreigaben, Triggerwarnungen oder gesellschaftlicher Ächtung unterhalten, aber damit würden wir dem eigentlichen Problem aus dem Weg gehen. Die Frage, wie wir verhindern, dass solche Stoffe in die Hände von Menschen fallen, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen oder können, ergibt sich notwendigerweise aus ihrer Existenz und muss geklärt werden, aber sie ist kein Ersatz für eine persönliche Haltung.
Lassen wir rechtliche, präskriptive und praktische Erwägungen also außen vor und nehmen einfach mal an, dass Kunst und Fiktion grundsätzlich alles dürfen, solange sie keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Dann sind nämlich wir als mündige Rezipienten und Konsumenten gefragt, deren gutes Recht es ist, uns nicht mit allem und jedem auseinandersetzen zu wollen. Jeder muss folglich selber wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt, welche Grenzen auch im Künstlerischen und Fiktiven gelten sollen.
Wenn wir das für uns beanspruchen, haben wir eine Reihe von Optionen. Wir können festgestellte Grenzüberschreitungen kurzerhand abstreiten oder ignorieren, um uns nicht den Spaß verderben zu lassen. Wir können auch, sobald wir in einem künstlerischen oder fiktiven Werk rassistische, misogyne oder sonstwie „problematische“ Aspekte ausgemacht haben, dieses Werk mit einem Bleimantel isolieren und zur Endlagerung nach Gorleben abtransportieren lassen. Das wären zwei extreme Reaktionen.
Ein Mittelweg wäre, sich die Problematik solcher Aspekte bewusst zu machen, sie zu thematisieren und zu diskutieren und von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das gegebene Werk sich seine Grenzüberschreitungen „verdient“. Kurz gesagt: Gibt mir als Leser dieser Comic irgendetwas, das mich seine möglicherweise „problematischen“ Aspekte in Kauf nehmen lässt, obwohl ich mir ihrer Gegenwart bewusst bin? Will ich Alan Moore lesen, obwohl mich seine beiläufige und regelmäßige Instrumentalisierung von sexueller Gewalt gegen Frauen abstößt? Will ich mich Tim und Struppi, Asterix oder Mecki, Eisners The Spirit oder Millers Holy Terror! trotz des darin transportierten Rassismus aussetzen? Brauche ich Cerebus in meinem Leben, das Opus Magnum des überzeugten Frauenhassers Dave Sim?
Eine universelle Antwort darauf gibt es nicht, und eine individuelle ist abhängig von der wahrgenommenen Schwere der Transgression, sowie persönlicher Erfahrung, Reife und Wertung – und kann sich zudem jederzeit ändern. Ein besserer Lösungsansatz ist mir bislang aber nicht eingefallen, also versuche ich fürs Erste, damit zu arbeiten.
Was heißt das nun, konkret auf Prison Pit bezogen?
Zunächst halte ich Ryan für einen mörderisch guten Cartoonisten, der keinerlei Skrupel hat, seine kranke Fantasie auf dem Papier auszuleben und in Prison Pit einen unwiderstehlichen erzählerischen Sog zu erzeugen versteht. Wenn sie so gekonnt und fesselnd umgesetzt sind wie hier, dann finde ich transgressive Sauereien ausgesprochen sexy. Das vorweg als Eingrenzung der persönlichen Geschmackskoordinaten.
Wenn ich mich nun bei Prison Pit unwohl fühle, dann glaube ich, dass das vom Autor so beabsichtigt ist. Bei Miura oder Moore hingegen fühle ich mich eher unwohl, weil ich den Eindruck habe, dass die Autoren sich der Problematik dessen, was sie tun, nicht wirklich bewusst sind. Darin liegt für mich ein Unterschied in der Beurteilung. Und – um Missverständnisse zu vermeiden – bei diesem Eindruck geht es auch überhaupt nicht darum, die Ansichten oder Aussagen der Autoren auf Anhaltspunkte abzuklopfen; es gilt vielmehr, diese als „problematisch“ empfundenen Elemente im Kontext des jeweiligen Werks nach bestem Wissen und Gewissen zu beurteilen. Nicht „Gesinnungsschnüffelei“ soll die Grundlage dieses Urteils sein, sondern ästhetische Analyse. (Vorausgesetzt, wohlgemerkt, man sucht die Auseinandersetzung. Ob man sich mit den Werken von Leuten wie Moore, Miller oder Sim, Brian Wood, Brendan McCarthy oder Orson Scott Card angesichts ihrer sonstigen öffentlichen Äußerungen und Aktivitäten überhaupt beschäftigen will, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.)
Im Übrigen gehört es für meinen Geschmack zu den zentralen Aufgaben der Kunst, uns Unbehagen zu bereiten in Dingen, bei denen wir Unbehagen empfinden sollten. Das ist erneut eine moralische und damit überaus subjektive, glitschige und universell kaum greifbare Kategorie, das ist mir bewusst. Aber sie ist deshalb nicht weniger essenziell. Ich mag Prison Pit sehr, und einer der Gründe dafür ist, dass es in mir Unwohlsein verursacht auf eine Weise, bei der mir das Werk den Eindruck vermittelt, dass das genau so gewollt ist.
Aber was meinst du, Wederhake? Ist das Kunst oder kann das bleiben? Darf der das? Ist der Film womöglich besser als das Buch?
![]()
* * *
WEDERHAKE: Frisch, die Nummer hast du schon bei Asteriops Polyps gefahren. Erst jahrelang das Maul nicht aufbekommen, dann über 2.000 Wörter zu ’nem Comic runterhobeln. Für die nächste 2gegen1-Ausgabe, die du dann 2016 beisteuerst, erwarte ich ’ne Rückkehr zur „maximal 10 Absätze“-Maxime, die wir hier mal hatten. Solche verkappten Dissertationen zur Populärkultur kannst du deiner Komparatistik-Professorin für angewandte Gender Studies vorsetzen.
Außerdem hast du Unrecht. Erst einmal mit Miura. Da habe ich jetzt ein paar weitere Bände gelesen und der wird stilistisch besser und scheint nicht völlig der Welt entrückt zu sein. Weniger krass in seiner Darstellung wird er aber nicht. Aber wo wir schon etabliert haben, dass du da Unrecht hast: Du hast auch Unrecht mit Prison Pit.
Also, du hast schon Recht, in gewisser Hinsicht: Prison Pit ist das platonische Ideal eines Actioncomics. „Cool, more shit to kill,“ ist ein Zitat aus dem Comic und fasst alles zusammen, was Johnny Ryan hier zelebriert. Kein Brimborium, kein Drumherum, kein Gelaber. Hier ist ein Ding, jetzt wird’s zerlegt und zwar so brutal und explizit wie möglich. Und weiter. Das alles, ironisch gebrochen, dargestellt in einem rechtwinkligen, steifen, komplett nicht aerodynamischen Strich, der wenig mit Ryans sonstigen Cartoons zu tun hat, ein wenig in Richtung Outsider Art geht und eigentlich komplett im Widerspruch zu dem steht, was Ryan hier präsentiert. Das würde eigentlich einen fluideren Strich erfordern, wie ihn Brandon Graham zum Beispiel derzeit in Prophet zeigt. Und, hey, die Gewalt und die Physical Comedy funktionieren trotzdem, meiner Ansicht nach aber besser in der animierten Version, bei der ich ein paar Mal ob des inhärenten Slapsticks lachte, während mich die gezeichnete Version nur leicht schmunzeln ließ.
Und jetzt zum Widerspruch: Prison Pit mag Satire sein und damit alles dürfen. Aber auch Satire, die alles darf, sollte eines tun: nicht stumpf werden. Und das wird Prison Pit ganz schnell. Johnny Ryan ist sich bewusst, wie er Unbehagen beim Leser erzeugt, stimmt. Alles was gesellschaftliches Tabu ist, zelebriert er genüsslich. Jede Körperfunktion und -flüssigkeit wird genüsslich und en detail präsentiert: Jede Öffnung in diesem Comic sieht aus wie eine Vagina, alles was phallisch wirken kann, ist auch ein Phallus, Urin, Kot, Erbrochenes, Blut, Phlegma, Smegma, Sperma. You name it, it’s there. Hier ist ’ne Vagina Dentata, mit der hat man schon im Mittelalter geschockt, da wird Götz von Berlichingen wörtlich genommen, bald wird ein Skrotum verzehrt und dann wird wieder ein spitzer Gegenstand in einen Penis gesteckt. Wenn es geht, dann tut Johnny Ryan es auch.
Aber für mich nutzt sich der Schockeffekt des ganzen Gelöts zügig ab. Nun hast du mich auch gezwungen, alle fünf Bände am Stück zu lesen und die sind vielleicht nicht dafür gedacht, in so komprimierter Form konsumiert zu werden, aber irgendwann fing ich an, durch die expliziten Fäkal- und Gewaltorgien leicht gelangweilt durchzublättern. Band 1? Was in Band 1 krasser Scheiß ist, das ist in Band 5 nur noch „been there, seen that“-Monotonie, die nur dadurch aufgelockert wird, dass die Monstrositäten, die Ryan zeichnet, auch im fünften Band noch cool bizarr und verstörend sind. Wobei mich das ein bisschen an die Gegner aus japanischen Videospielen der frühen Neunziger, Gargoyle’s Quest und Atomic Zombies, erinnerten.
Vielleicht liegt’s auch daran, dass ich als deutscher Jugendlicher – nicht nur von Brösel – so sozialisiert wurde, dass Fäkalhumor eh die Ausgangslage allen Humors zu sein scheint, viele der auf die USA abzielenden Tabu-Brüche lassen mich da irgendwie kalt. Konstanter Tabubruch wird irgendwann auch monoton und bloß, weil man sich bewusst ist, dass man explizit gegen die politische Korrektheit verstößt, macht das ein Werk noch nicht aus sich heraus lesenswert. Nun bin ich aber in meinen popkulturellen Eskapaden auch lieber Eskapist als Intellektueller. Wenn ich mich zwischen Blankets und Nemesis – The Warlock entscheiden muss, dann gewinnt Nemesis.
Und ich habe bei Prison Pit das anhaltende Gefühl, dass da von den Kritikern ein Haufen intellektueller Gymnastik betrieben wird, um Prison Pit gar nicht erst in den Ruf kommen zu lassen, dass Johnny Ryan vielleicht doch primär ein Shock Jock mit leicht intellektuellen Neigungen ist. Die Penisse und Vaginen werden zur Manifestation tiefenpsychologischer Phänomene. Und dann wird halt ’ne Master-These aufgestellt, warum das Vergewaltigungsmotiv hier nicht einfach nur ’ne billige Episode ist, sondern ein meisterlicher Diskurs zu Genderrollen und der Normalisierung des Schreckens in der Rape Culture bei dem Andrea Dworkin vor Ehrfurcht die Zigarre aus dem Mund gefallen wäre.
Und wenn das bei dir beim Lesen die erste Assoziation und Gedankenreihung war: Glückwunsch, du bist deeper als ich. Aber diese intellektuelle Legitimation kann man auch für das „69-11“-Panel hinbekommen, das in deinen Links zu finden ist. Oder für das, was man in ’nem durchschnittlichen Troma-Film sehen kann. Anders als du finde ich die Miura-Comics ehrlicher und erträglicher als Prison Pit, weil ich da die Dinge, die ich störend finde, ansprechen und evaluieren und bewerten und einordnen kann. Prison Pit hat im Kontext zum Rest, den Johnny Ryan fabriziert, immer dieses gefühlte, selbstgefällige Grinsen auf jeder einzelnen Seite.
Klar, es provoziert den Leser, aber in einer Form, die ich billig finde. Das ist so post-ironisch, dass es quasi unangreifbar wird: „Widert dich das an, Leser? Dann bist du ein Heuchler, weil du die Gewalt, die ich hier in ihrem Extrem präsentiere, doch sonst implizit hinnimmst. Findest du das billig, Leser? Dann bist du ein Narr, weil du intellektuelle Ebene, die sich hier findet, den pointierten Diskurs zu großen Themen unserer Zeit, nicht zu sehen vermagst, du Philister.“ Da mag ich’s dann doch lieber, wenn ein Comic dazu steht, dass er solche Dinge bringt, weil er sie bringen will, statt sie in ein argumentatives Korsett für all jene Leser zu zwängen, die so ’nen Kram ja sonst nicht mit der Kneifzange anfassen würden. Aber ich bin vielleicht auch einfach nicht smart genug, um die tollen neuen Kleider des Kaisers zu sehen.
Meine 45 Minuten Schreibzeit gehen hier so langsam zu Ende, ich versuche mich also nochmal an ’ner Art abschließender Einordnung meiner Gedanken: (1.) Prison Pit ist exakt so intelligent oder stumpf geschmacklos, wie der Leser es sehen will. Mehr ein Lackmus-Test für die Haltung des Lesers zu Johnny Ryans Attitüde als ein Lackmus-Test für seine Qualitäten oder den Mangel derselben. (2.) Trotzdem ist der erste Band ein Musterbeispiel dafür, wie man den Actioncomic in seine elementaren Komponenten zerlegt und dabei implizite Untertöne so explizit wie möglich macht. Das braucht ein grundsätzliches Können, das ich Ryan nicht absprechen kann und möchte. (3.) Das trägt aber nicht über fünf (und mehr) Bände, besonders wenn man sie komprimiert in etwa einer Stunde liest. Ist der Unterschied zwischen ’nem Tritt ins Gesicht, der einen Morgens weckt (merkt man, dass ich noch vom Besuch in Saarbrücken traumatisiert bin?) und ’nem Stiefel, der auf ein Gesicht tritt – unaufhörlich – bis es zu ’nem dumpfen, schmerzhaften Hintergrundrauschen wird, das alle aufweckenden Elemente des einzelnen Trittes übertönt.
![]()
Prison Pit, Books 1 bis 5 (Comic)
von Johnny Ryan
Fantagraphics Books, 2009-2013
Softcover, schwarzweiß, englisch, je ca. 115 Seiten, je 12,99 US-Dollar
ISBN: 978-1-606-99297-5 (Book 1)
ISBN: 978-1-606-99383-5 (Book 2)
ISBN: 978-1-606-99497-9 (Book 3)
ISBN: 978-1-606-99591-4 (Book 4)
ISBN: 978-1-606-99700-0 (Book 5)
Johnny Ryan’s Prison Pit: Book One (Film)
von Greg Franklin, Johnny Ryan, Greh Holger et al.
mit James Adomian, Blake Anderson, Kyle Kinane und Rick Shapiro
Six Point Harness Studios, 2014
DVD, farbig, englisch, 16 Minuten, 6,99 US-Dollar
http://www.prisonpit.com
Abbildungen: © Kentaro Miura/Hakusensha/Dark Horse/Panini und Johnny Ryan/Fantagraphics

Pingback: Gigantomachie |
Pingback: Währenddessen… (KW 20) |
Pingback: Requiem |